Bühne als Hyperraum
1. Bühne und Zimmer
Das Primäre am Theater ist die Bühne. Die Bühne ist schon da, bevor der Vorhang aufgeht. Die Bühne ist schon da, bevor ein Theaterstück eingeübt, bevor es überhaupt erdacht und aufgeschrieben wird. Die Bühne ist schon immer da gewesen, hypothetisch stammt sie aus einem zeitlichen Davor, das die Matrix bildet, in die hinein sich das Theatergeschehen entwickelt und in der es real wird: - real in der erlebten Gegenwart, die eine Gegenwart der Anwesenheit ist. In seiner gültigen Konkretion bezieht sich das Theater mit Mensch, Wort und Handlung auf den bespielbaren Raum, der schon da ist und schon immer da gewesen ist. Denn die Bühne ist das Alpha und Omega des Theaters. Hypothetisch existiert sie als uranfängliche Räumlichkeit. Sie war schon vor den Menschen da und wird sie auch überdauern. Insofern könnte man sogar davon absehen, dass sie von Menschen gemacht ist, hypothetisch zumindest, und sie als etwas apostrophieren, das älter ist als alles Menschliche, älter als die Menschheit selbst, wie der Raum, dessen Funktionen sie repräsentiert, ja auch etwas ist, das schon lange vor den Menschen da gewesen ist, ein expandierendes Produkt des Urknalls. Und natürlich ist das nur ein Gedankenspiel. An jedem Theaterabend wird die Bühne neu "aufgelegt". So wie ein Tisch vor jeder Mahlzeit neu gedeckt wird. Ja, das ist banal. Die Banalität des Theaters besteht eben darin, dass es seinen Schauplatz zwar unabdingbar braucht, ihn aber auch verschwinden lässt. Wenn etwas immer wieder da ist, unabdingbar und gebrauchsfertig, wird es zur Banalität und verschwindet in sich selbst. Die Bühne ist ein Raum, der in sich selber Räumlichkeit realisiert. Räumlichkeit als Abstraktum. Was im theatralen Geschehen auf dieses Abstraktum zielt, ist transzendent, überschreitet den real vorhandenen Ort (der keineswegs unendlich ist) und verweist auf den primären Raum des Schon-immer-Dagewesenen. Dieser Raum ist neutral, weil er keine Begrenzung kennt. Er verliert sich im Dämmer seines Schon-immer-Dagewesenen. Das sicht- und erlebbare Theaterstück ist das, was von der Bühne abstrahiert wird, was die Bühne aber auch an ihren Urgrund zurückbindet. Es ist das, was die kosmische Qualität des schon immer da gewesenen Bühnenraums mit jedem Theaterstück neu zur Disposition stellt. Und zwar in einer sichtbaren und konkreten Form. Das potentiell Unbegrenzte des Bühnenraums – diese geheimnisvolle raumzeitliche Lemniskate, die sich dem sinnlichen Verständnis radikal entzieht – wird in der theatralen Realisierung fassbar, eingrenzbar und wiederholbar. Dasselbe lässt sich auch über ein Zimmer sagen. Ein Zimmer wird in der Regel von Menschen in Anspruch genommen, die es betreten, um darin etwas zu tun. Bevor sie jedoch das tun, wofür auch immer ihnen das Zimmer geeignet erscheint, ist das Zimmer schon da, und wenn sie nach Beendigung ihrer Tätigkeit wieder hinausgehen, bleibt das Zimmer in der Regel da, wo es schon vorher gewesen ist. Und - der Möglichkeit nach, hypothetisch - schon immer gewesen ist. Es bleibt da und wartet auf den nächsten Auftritt, die nächste Handlung. Tautologisch ist das insofern, als der Vollzug einer Zimmerhandlung (an einem Tisch sitzen, aus dem Fenster schauen, ins Bett gehen) mit dem Zimmer an sich wenig zu tun hat. Streng genommen eigentlich gar nichts. Der Witz der Ermöglichung dieses Tuns liegt gerade darin, dass das Zimmer neutral ist. Bei seiner Benützung und Inanspruchnahme wird der Ort, also das Zimmer, auf seltsame Weise ausgespart, aus sich selber ausgeschlossen. Es ist ein Ort der Selbstnegation, Ort und Unort zugleich. Wirksam ist dieser Ort oder Unort nur deshalb, weil er in Bezug auf den Inhalt seiner Benützung keinerlei Geltung oder Bedeutung beansprucht. Ich gehe nicht in ein Zimmer, um zu „zimmern“. Ich gehe nicht in ein Zimmer, weil ich den Aufenthalt in diesem Zimmer als Selbstzweck betrachte. Wenn ich mich in einem völlig leeren Zimmer darauf konzentriere, jede Handlung zu vermeiden, ist das gleichwohl noch eine Handlung, die sich nicht auf das Zimmer bezieht, sondern auf irgendeine Absicht jenseits des Zimmers, und sei diese Absicht auch auf das Nirwana ausgerichtet, die völlige Entleerung des Bewusstseins. Wenn ich meditiere oder einen Unfall erleide und in Ohnmacht falle und infolgedessen aus meinem Bewusstsein heraustrete, tue ich damit ja immer noch das, was ich unter „Nichtstun“ oder „Nichts-Vorsätzliches-Tun“ verstehe. Wie ich es auch immer damit halte, ich „zimmere“ nicht. Das Zimmer ist keine Einrichtung wie ein Meditationsraum oder eine Toilette. Das Zimmer ist auch nicht ein Ort, den man aufsucht, um in Ohnmacht zu fallen. Das Zimmer an sich hat keinen Zweck, den ich sinnvollerweise verfolgen könnte, es sei denn, ich betrete es in der Absicht, einen Umbau vorzunehmen. Dazu muss ich aber den natürlichen Nicht-Zweck des Zimmers substrahieren. Solange ich das Zimmer umbaue, ist es nicht benutzbar. Auch in seinem Nicht-Zweck. Als Zimmer-Bewohner und Zimmer-Benutzer kann ich das Zimmer immer nur unter dem Aspekt einer zimmerfremden Intention betrachten, nach einer paradoxen Zimmer-Logik. Ich nehme es in Anspruch, ohne damit auch nur im geringsten auf das Zimmer abzuzielen. Das Zimmer an sich bleibt mir verborgen. Ich nehme das Zimmer zwar wahr, aber eben nicht als Zimmer, sondern als Stube, Toilette, Estrich etc. Ich schreibe dem Zimmer Eigenschaften zu, die ich mir zunutze mache. Die ich gegebenenfalls auch neu definieren kann. Am Zimmer aber ändere ich nichts. Das Zimmer selber bleibt mir verborgen. Ich gehe also nicht in ein Zimmer, um zu „zimmern“. Genauso wenig wie ein Schauspieler auf die Bühne geht, um die Zuschauer davon zu überzeugen, dass er schauspielert. Und bitte, es solle doch niemand erschrecken, wenn er, der Schauspieler, im dritten Akt den Geist aufgebe, das sei nur vorgetäuscht... Natürlich kann ein Schauspieler genau das tun, er kann das Schauspielern aufheben und die Zuschauer "einweihen", im postdramatischen Theater fast schon der Regelfall. Doch die Selbstreferentialität, mit der sich die Schauspieler im postdramatischen Theater als Schauspieler kenntlich machen, lassen wir hier mal beiseite, verstösst sie doch nur scheinbar gegen das Tautologische, im Gegenteil: wenn Schauspieler willentlich aus ihrer Rolle fallen und die Fiktionalität des Spiels durchbrechen, vermindern sie damit die Tautologie ihres Erscheinens nicht im geringsten, sondern versehen es sogar noch mit einem Ausrufezeichen. Dass ihnen, den Schauspielern, die Bühne die Möglichkeit an die Hand gibt, Hamlet oder Othello zu sein, muss dem Publikum nicht eigens erklärt werden. Und dass die Bühne nur dazu da ist, etwas anderes als Bühne zu sein, ist ein Axiom, das die Parabel von des Kaisers neuen Kleidern moralisch und ästhetisch bestätigt. Je nackter der Kaiser, desto grösser seine Macht über die Phantasie. Die Bühne ist ein Schauraum, ein Dispositiv für die Darstellung und Sichtbarmachung eines Geschehens, das sich auf ihr vollzieht. Aber sie ist auch ein Raum, der genau das meint, was die Ortsbestimmung vieler Theaterstücke in mehr oder weniger subtiler Kongruenz abbildet und vordefiniert: dass nämlich Menschen ein Zimmer betreten und in diesem Zimmer miteinander interagieren. Am einfachsten zu bewerkstelligen ist dies in einem Kammerspiel. Dort ist das Äusserliche (die sichtbare Bühne) mit dem Innerlichen (dem behaupteten Handlungsort) weitgehend kongruent. Im Kammerspiel bilden Handlungsort und Bühne eine gefühlte Einheit. Wenn die Figuren nichts anderes tun, als ein Zimmer zu betreten, in dem Zimmer irgendeine Situation zu erzeugen und das Zimmer wieder zu verlassen, vollziehen sie die grösstmögliche mimetische Annäherung an den real vorhandenen Bühnenraum. Hier findet eine Verschmelzung statt, in der das Theater seine räumlichen Möglichkeiten auf den Mindeststandard bringt. Im wesentlichen ist die Bühne nichts anderes als ein Zimmer, bei dem eine Wand fehlt. Und natürlich ist es ausgerechnet die Wand zwischen Zimmer und Publikum. Dass sich die Indiskretion des einsehbaren Raums als Standardmodell des theatralen Blick-Dispositivs etabliert hat, könnte unter anderem daran liegen, dass sich der moderne Mensch nicht als Teil einer anonymen Masse begreift, sondern als einzelnes, selbstbestimmtes Indiviuum, das sich aus eigener Kompetenz zum Schauen und Deuten ermächtigt. Anders als im Zirkus oder in der Sportarena verschwindet man als Theaterbesucher nicht in einer formlosen und ablenkbaren Masse, die sich selektiv ergötzt. Man setzt sich der Bühne frontal gegenüber, und man zwingt sich in ein Kästchen hinein. Was man da vor sich hat, ist etwas Modellhaftes, ein ideelles und räumliches Puppenstubenzimmer, in dem die wirklichen oder möglichen Belange der Zuschauer live - also im Hier und Jetzt - verhandelt werden. Dieses ich-zentrierte Schauen wird im Theater systematisch eingeübt und kultiviert. Die Theaterbühne in der Form eines zuschauerseitig offenen Kastens privatisiert das Schauen, führt es ins Eigene und Individuelle. Was sich mit einem Grossteil der Handlungsmöglichkeiten deckt, die als besonders "bühnentauglich" gelten. Viele Theaterstücke spielen in Zimmern. Die Ortsbestimmung „Zimmer“ oder „Raum“ setzt einen Handlungsrahmen, der für die Bühne prädestiniert scheint. Ein möblierter oder unmöblierter Innenraum ist wie die Bühne, die ihn umfasst und darstellt, durch Wände begrenzt. Die Bühne als Ur-Setting der Bühnenhandlung fällt mit dem imaginierten Raum zusammen. Da fehlt nur gerade die Wand im Vordergrund. Dank diesem Kunstgriff wird das bespielte Zimmer nicht nur einsehbar, es wird zu etwas Künstlichem und bildet eine Anordnung, die als solche offenliegt: erkennbar, deutbar und mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, da man die Dinge auf ihr auch ganz anders anordnen könnte. Das Bühnenzimmer ist fragil. Bühnenstücke sind also in besonderem Masse Zimmerstücke, da gehen Personen körperlich und leibhaftig in einem Raum aufeinander zu, sprechen miteinander, interagieren im natürlichen Handlungsradius des menschlichen Körpers. Eine Verfolgungsjagd mit Autos ergäbe auf einer Bühne keinen Sinn. Ein Ritt durch die Prärie wäre eine bühneninszenatorische Unmöglichkeit. Eine Bergbesteigung und die Begehung der chinesischen Mauer ebenso. Bricht das Theater mit seiner Nähe zum Innenraum, so muss sich der Bühnenbildner etwas einfallen lassen: denn die Bühne ist ja nicht identisch mit dem Zimmer, das sie so häufig darstellt. Sie kann vom Zimmer abstrahiert werden. Wenn die Bühne eben kein Zimmer mehr ist (nicht mehr deckungsgleich mit sich selbst), sondern ein Ort der imaginativen Erweiterung. Diese Zweiteilung ermöglicht eine Projektion auf sich selbst. Die Bühne bleibt ja immer ein Raum, der seine räumlichen Möglichkeiten in Anschlag bringt. Aber zugleich projiziert er mit Hilfe ebendieser Möglichkeiten einen imaginären Raum in sich selber hinein, den die Schauspieler – auch sie gleichsam verdoppelt durch die Mimesis – physisch und verbal in Besitz nehmen. Die Differenz zwischen Projektion und Realität erweist sich als der urtypische theatrale Spielraum, der nur auf der Grundlage der paradoxen Zweischneidigkeit von Realraum und Imagionatinsraum, von echt in Erscheinung tretenden Menschen und gespielten Rollen überhaupt zur Wirkung kommen. Wird diese Wirkung gebrochen – im postdramatischen Theater eigentlich der Regelfall – ist das Massgebliche immer noch das, was dieser Wirkung zugrunde liegt. Von ihr wird abstrahiert. Sie ist und bleibt die Richtschnur für alles, was sich Theater nennt.
2. Jules Verne im Theater
Jules Verne im Theater? Ja, das geht - und wird auch oft gemacht. Aber wie kommt ein Theater dazu, sich ausgerechnet Jules Verne zur Brust zu nehmen? Die markigen Abenteurer und wortgewandten Universalforscher, die Verne in alle Himmelsrichtungen ausschickt, in die tiefsten Meeresgräben, auf die höchsten Berge und sogar ins Weltall, passen in ihrem unermüdlichen Bewegungsdrang überallhin, nur nicht auf die Bühne. Einen Jules Verne für die Bühne gibt es wahrscheinlich nur unter der Voraussetzung, dass man ihn zum Vaudeville herabwürdigt. Abgesehen vom typischen Entdeckerdrang des 19. Jahrhunderts, den Verne unablässig durchdekliniert, verfügen seine Anziehfiguren kaum über Eigenschaften, die irgendeine grössere Dramatik in Gang setzen könnten. Mit sich selber stimmen sie derart perfekt überein, dass man ihnen eine reale Existenz gar nicht so richtig abkaufen mag. Wie die Typisierung der klassischen Temperamente (Sanguiniker, Choleriker etc.) lassen sie für Individuelles wenig Spielraum. Und Helden sind sie eigentlich nur beiläufig. Ihre Daseinsberechtigung finden sie vorwiegend darin, dass sie die phantastischen Raumerfahrungen, die der Autor seinen Lesern vermitteln will, reflektieren und verbalisieren. Es sind, vom dramaturgischen Gesichtspunkt aus gesehen, eher passive als aktive Figuren, eher Funktionsaggregate als Menschen aus Fleisch und Blut, die in ein individuelles Schicksal verstrickt sind. Vernes Helden haben anscheinend kein individuelles Schicksal, kein Leben neben dem Abenteuer, das ihnen der Autor auferlegt. Das Abenteuer zwischen den Buchdeckeln ist ihr einziges Schicksal. Damit trumpfen sie auf, doch als Charaktere wirken Professor Aronnax, Fergusson, Michel Ardan und Konsorten ziemlich austauschbar, ziemlich eindimensional und zweckorientiert. Im Vernschen Role play treten sie, geschniegelt und wetterfest bis zur offensichtlichen Ironie, ausschliesslich in der Funktion von Beobachtern und Kommentatoren auf. Mit ihnen identifizieren kann man sich nur bedingt. Immerhin sind sie nützlich. Auch deshalb, weil sie so wenig Luftwiderstand bieten. Der Erzähler hat sie auf den Plan gerufen, damit sie einem überallhin vorangehen. Womit er die Lektüre, sprich die Akzeptanz des Phantastischen für die Leser erleichtert. Auf der Reise ins Unbekannte ermutigt nichts so sehr wie ein Gefährte, der auf flottes Vorankommen konditioniert ist, ein Mensch, der leichtbeschuht durch die Welt eilt und andern und sich selber nicht im Weg steht. Kommt er doch mal ins Stolpern oder verwickelt sich in Schwierigkeiten, so hat das immer sein Gutes. Durch kleine Hindernisse, Versäumnisse und Umwege wird der Weg noch einen Tick spannender. Vernes Figuren entsprechen diesen Vorgaben fast zu gut. Sehr exakt (und allzu offensichtlich) sind sie auf die Abenteuer zugeschnitten, die sie zusammen mit den Lesern zu bestehen haben. Es sind Figuren, denen man sich anschliesst, nicht obwohl, sondern weil sie kaum irgendein dramatisches Profil oder Gewicht besitzen. Jede Konfliktlastigkeit geht ihnen ab, die Tragik eines Don Quichotte oder Kapitän Ahab blitzt bei ihnen nicht einmal im Scheitern auf. Sie haben etwas Unverwüstliches, etwas Unangreifbares, was vermutlich daran liegt, dass sie keine Menschen sind, sondern Typen und Funktionsträger. Die Kugeln prallen sozusagen an ihnen ab. Im Abenteuer der Raumerschliessung sind sie lediglich die mehr oder weniger kundigen Begleiter, auf die man im Vertrauen auf die etwas hölzernen Grundtugenden, die Verne seinen Helden mitgibt, immer und überall zählen kann. Bei Verne hat das Wort "überall" eine Ausrichtung, die sehr konventionell ist: das Räumlich-Geografische wird als die eigentliche Herausforderung für den menschlichen Geist begriffen. Die Verne-Lektüre ist denn auch über weite Strecken eine Lektüre der Raumerschliessung. Dabei kommt es zu einer paradoxen Verschiebung. Je grösser und faszinierender die Räume, die der Autor imaginiert, desto beliebiger und austauschbarer erscheinen seine Figuren. Manche schrumpfen zu Ameisen, manche verschwinden fast ganz. Die Welt, in die sie vorstossen, ist so riesig, so unglaublich, dass die staunenden Welterforscher daneben fast verschwinden. Abzulesen ist das auch an den Original-Illustrationen: die Figuren scheinen oft wie mitten in einer Bewegung paralysiert zu sein, mit vor Staunen aufgerissenen Mäulern in einer Umgebung, die dieses Erstaunen sichtbar verursacht. Darin ähneln sie den winzigen, modisch einwandfrei gekleideten Figürchen, die der Landschaftsmaler vor sein Bergpanorama stellt, um die Wildheit und Erhabenheit der Natur umso deutlicher hervortreten zu lassen. Dieser Mechanismus greift bei Jules Verne ganz hervorragend. Vor allem dort, wo sich hinter jedem erforschten Raum ein weiterer Raum auftut, der noch grösser und aussergewöhnlicher ist als alle vorangegangenen Räume. Wo sich ein Leporello der Räume auffaltet, ein kosmisches Panoptikum, wo das Noch-nie-Gesehene in immer neuen Grossartigkeiten gipfelt und der Pioniergeist, der dies alles entdeckt und registriert, auf eine Rutschbahn gerät, die paradoxerweise nichts ins Offene führt, sondern mitten hinein in die Rumpelkammer eines überfüllten Museums. Dort landet der Pioniergeist - man könnte sagen: auf seinem Hintern. Aber sagen wir es anders: er setzt auf dem Boden der Tatsachen auf, und zwar in der Gestalt eines zotteligen Forschers, der zuerst einmal seine verrutschte Brille und seinen zerbeulten Hut in Ordnung bringen muss, bevor er sich dazu beglückwünschen kann, dass er die Prüfung bestanden und das Weltwissen ein Stückweit vorangebracht hat. Bei Verne verbindet sich das Pragmatische mit dem Phantastischen auf eine Weise, die uns nicht in der Luft hängen lässt. Zumindest nicht vollständig. Nun ja, ein bisschen vielleicht schon. Das nicht ganz eingehaltene Versprechen, in der Vermehrung des Weltwissens Phantasie und Gefühlsreichtum aufrechterhalten zu können, beinhaltet auch ein Quentchen Ernüchterung. Verne inventarisiert die Welt, indem er sie riesengross aufbläst, um dann in sie hineinzustupfen, worauf sie mit einem Knall zerplatzt. Das hat zweifellos etwas Vergnügliches: nur hat es eben die Wirkung, dass man die Vernschen Helden als Anziehfiguren und Hansdampfe in allen Gassen wahrnimmt. Jederzeit stehen sie auf dem Posten, und wenn sie umfallen, stehen sie im nächsten Moment wieder auf. Sie sind unverwüstlich - und als Charaktere etwa so interessant wie Sportler, bei denen man immer dankbar ist, wenn sie das Maul halten. Was Vernes Helden bezüglich ihrer Reisen darstellen und berichten, interessiert uns nicht deswegen, weil diese Reisenden besonders interessant wären. Unser Interesse wird durch etwas anderes geweckt. Das ist wie bei einer Flaschenpost. Der Absender erscheint unwichtig. Die Sensation, die eine Flaschenpost darstellt, liegt weniger in der Person des Absenders, die auch anynom sein könnte, als im Fund der Flaschenpost, in der "unglaublichen" Verkettung von Zufällen, die diesen Fund erst ermöglicht haben. So wenig wie der Absender ist es die in der Flasche enthaltene Botschaft, was bei diesem Fund als sensationell empfunden wird, es ist der Fund selbst, die Tatsache, dass die Flasche einen langen und wundersam zufälligen Weg bis zu dem Punkt zurückgelegt hat, wo sie gefunden und entstöpselt wird. Nach diesem plausiblen und wirkungsvollen Muster funktionieren auch Vernes Abenteuerromane. Sie kommen zu uns wie die Mitteilungen einer Flaschenpost. Was sie uns erzählen, ist insofern gar nicht so wichtig, als sie eigentlich immer nur davon handeln, wie ein Mensch (oder eine Menschengruppe) von einem bekannten Punkt A zu einem unbekannten Punkt B gelangt. Darin erschöpft sich die Mitteilung der Vernschen Flaschenpost. Oder besser gesagt: wenn Verne uns mit seinen Geschichten packen und in Spannung halten kann, dann liegt es eben nicht an den schablonenartigen A-nach-B-Storys. Der Erzählgestus dieser immergleichen Bewegung in die erweiterten kosmischen Räume lässt die jeweiligen Verwicklungen und Motive wie auch die Protagonisten (die fiktiven Absender der Flaschenpost) in den Hintergrund treten, verwehrt ihnen jede Aufdringlichkeit und Bedeutung. Was bei Verne wirklich zählt, ist die erkundete Ferne, von der die Geschichten wie auch die Protagonisten Zeugnis ablegen. Vernes Erzählungen sind vor allem deswegen so spannend, weil sie aus einer unglaublichen Entfernung zu uns Lesern gelangt sind. Und weil sie genau das bezeugen und wissenschaftlich dechiffrieren, was in diese Entfernung sinnstiftend eingeschrieben ist: die noch-nie-erreichte, noch-nie-gesehene Ferne, der imaginäre Punkt hinter dem Horizont. Die Mittel, die Verne einsetzt, um uns dorthin zu bringen, sind ausserordentlich vielfältig und einfallsreich. In seinen Reiseberichten mischt sich Wissenschaft mit blühender Phantasie, Faktenwissen mit Spekulation. Variabel sind auch die Schauplätze und Fortbewegungsarten. Was sich jedoch als Konstante durch die meisten Verne-Romane hindurchzieht, ist das Narrativ einer Bewährungsprobe, in der ein potentiell unendlicher Raum durchquert und überwunden werden soll, was jeweils in einem dramatischen Durchbruch gipfelt, der das visionär gegebene Versprechen auf das "ganz Andere" einlöst und zugleich zurücknimmt. Verne schafft hier eine Ambivalenz, die durch die Zurücknahme eines alten Versprechens ein neues und aufregendes Versprechen in den Mittelpunkt stellt: nämlich dass durch jede Pioniertat und jede Entdeckung das geistig-moralische Vermögen der Menschheit zunimmt. Mit diesem Versprechen wird suggeriert, dass die Mysterien im Zeitalter der positivistischen Wissenschaft nicht einfach verschwinden. Sie verlieren ihre Berechtigung nicht. Wunder verschwinden nicht, nur weil man sie erklären, d.h. auf rationale Ursachen zurückführen kann. Dennoch kann Jules Verne, so gerne er es vielleicht möchte, die Welt nicht von Grund auf neu verzaubern. Die Ambivalenz des gelüfteten Geheimnisses begleitet ihn auf Schritt und Tritt. In jedem Moment, da Verne seine Helden mit dem Wunderbaren konfrontiert, wächst das Welt-Lexikon um einen weiteren Eintrag. Durch den Zugriff der Forscher wird das Wunderbare verdinglicht und versachlicht. Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts hat das freilich einen etwas naiven Beigeschmack, leben wir doch in einer Zeit, in der eine Erweiterung des Wissens nur noch auf Kosten der Verständlichkeit möglich ist. Wissenschaft und Mysterium sind kaum noch Gegensätze. In der Quantenphysik, in der Weltraumforschung, in der Chaostheorie und selbstverständlich auch in Einsteins Relativitätstheorie sind wir mit Erkenntnissen konfrontiert, die unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigen. In der Zeit von Jules Verne gab es diese Diskrepanz, wenn überhaupt, erst als Vorahnung. Wer Wissenschaft trieb, konnte seine Erkenntnisse in jede Abendkonversation einstreuen - und niemand fühlte sich davon vor den Kopf gestossen. Der interessierte Laie konnte noch überall mitreden. Bis zum Mysterium der Unanschaulichkeit war es noch weit. Jules Verne musste dieses Mysterium künstlich herstellen: eben schriftstellerisch, als Phantast und Visionär. Damit aber ging er einen seltsamen Kompromiss ein. Die Wissenschaft seiner Zeit gab das, wovon er träumte, die quasi-mystische Liaison zwischen Ratio und Phantasie, noch nicht her, jedenfalls war die Empirie, der Glaube an das Sichtbare, Messbare und Darstellbare, im 19. Jahrhundert so allgegenwärtig, dass sich auch ein Visionär wie Jules Verne nicht darüber hinwegsetzen konnte. Als wissenschaftsbegeisterter Schriftsteller blieb ihm keine andere Wahl, als die wissenschaftlichen Methoden und Ideen seiner Zeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und gerade das ist es, was uns heute an Jules Verne, dem Vater der Science Fiction, so eigentümlich berührt. Seine visionär getriebenen Wissensexkursionen sind noch mit dem Charme der Kuriositätenkabinette behaftet, mit der braven Übersichtlichkeit jener Schautafeln, die man noch bis vor kurzem in den Schulzimmern aufgehängt hat, um auch dem lernunwilligsten Kind begreiflich zu machen, dass Fleckvieh und Lurche irgendwie miteinander verwandt sind. Wenn bei Verne die Wissenschaft noch exoterisch war, so ist sie heute hochgradig esoterisch, weit weg von jedem Alltagsverständnis. Am deutlichsten wohl in der Quantenphysik. Vernes Enthusiasmus, typisch für den Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts, gilt einer Welt, die man verstehen und beschreiben kann. Und die jeder schlaue und zupackende Weltenbürger bereisen kann, auch wenn dabei sein Hut vielleicht ein bisschen zerbeult wird. Natürlich ist diese Welt potentiell unermesslich, ihre Grenzen unendlich erweiterbar, aber eben nie in die Richtung, in die noch ein Dante strebte, in die höheren Sphären jenseits des Erklärbaren. Verne entführt uns nicht in ein Jenseits, sondern immer nur dorthin, wo das bis dahin Unvorstellbare klassifizierbar und beherrschbar wird. Jules Verne träumt seine Träume als Angesteller einer kartografischen Anstalt oder als ein mit Ärmelschonern ausgerüsteter Redakteur der Encycklopedia Britannica, der eher gegen Tintenflecken als gegen Riesenkraken kämpft. Der wörtlich verstandene Weltraum mit seinen wechselnden Kulissen wird bei Verne zu einer Art virtueller Bühne für die Selbstverwirklichung des menschlichen Geistes. Verne spielt die Wechselwirkungen von Raum und Geist, physischer und geistiger Progression auf allen Ebenen des Phantasierens durch. Und darin liegt denn auch seine besondere Eignung für das Theater. Diese Eignung liegt nicht in den Figuren oder deren dramatischen Verwicklungen. Abgesehen vielleicht von einem gewissen utopischen Potential, das jeder halbwegs geschickte Intendant aus ihnen herauskitzeln kann, geben Vernes Stoffe für das Theater nicht sonderlich viel her. Zumindest könnte man das meinen, wenn man nur die Handlungen (Plots) und die Figuren als Masstab nimmt. Was bei Verne jedoch hervorragend mit den Bedingungen der Bühne zusammengeht, ist das vielschichtige Verhältnis zum Raum und zur Räumlichkeit, das er seinen Figuren angedeihen lässt. Hier erweist sich Jules Vernes Werk als ideale Theatervorlage. Die räumlichen Mechanismen und Möglichkeiten des Theaters sind in seinen Abenteuerromanen instinktsicher prädisponiert. Fast scheint es, als hätte er beim Schreiben eine Bühne vor dem inneren Auge gehabt. Rätselhaft ist das nicht. Seine schriftstellerische Karriere begann er als Stückeschreiber: jedoch nicht aus einer besonderen Neigung zum Theater heraus, sondern vorwiegend aus finanziellen Gründen. Dennoch kann man eine gewisse Nähe zur Bühnenmaschinerie in seinen Romanen unschwer erkennen. Die Neigung zum Theater, die man Jules Verne eigentlich absprechen müsste, da er als Romanautor und nicht als Dramatiker in die Literaturgeschichte eingegangen ist, dringt in bestimmten Bereichen seiner Texte wie etwas Verdrängtes an die Oberfläche und winkt mit dem Zaunpfahl.
3. Die räumliche Dialektik des Theaters
Die Bühne stellt eine wahrnehmungsmässige Begrenzung eines potentiell unendlichen Raums dar, eines Erzählraums wie auch eines geografischen Raums. Erweiterbar ist dieser Raum durch die Andeutung einer Fortsetzung, durch Raumteiler, Kulissen, Verhüllungen, Lichteffekte und Verdunkelung. Jules Vernes Raumexplorationen scheinen die Bühne zu sprengen, für das Theater müssten sie eigentlich denkbar ungeeignet sein. Doch weil es bei Verne um progressive Raumprojektionen geht - die Helden imaginieren oder erträumen Räume, die sie auch physisch in Besitz nehmen - und weil die Bühne eine räumlich-materielle Anlage ist, die sich als Handlungsraum in sich selber hineinprojiziert, geht hier das scheinbar Nicht-Vereinbare bestens zusammen. Wir erinnern uns: die Bühne ist wie ein Zimmer. Sie ist neutral, nicht festgelegt in dem, womit sie bespielt wird. Sie ist, um den Zimmervergleich noch ein wenig zuzuspitzen, eine Black Box. Als Black Box bietet sie jedoch Raum für Entgrenzung. Auf der Bühne lässt sich phantasierend voranschreiten in der imaginären Erweiterung des Räumlichen, die vielfach erfahren werden kann, weil die Bühne nun mal beschränkt ist, nicht nur räumlich, sondern auch in ihrer Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen. Anders, als man vielleicht denken könnte, ist der Film gar nicht das Medium, das mit Räumen und Raumerkundungen sonderlich souverän umgehen kann. In der Wiedergabe von Raumerfahrungen verhält sich der Film verhältnismässig unbeholfen. Wohl kann er Räume begehen und befahren, kann die Perspektive wechseln, Distanzen überwinden und die Welt sogar auf den Kopf stellen. Doch die elementare Raumerfahrung der Bühne bleibt ihm verschlossen. Gehen wir nochmals zum Zimmer-Vergleich zurück. Wie das Zimmer ist die Bühne ein Raum, der zugleich einschränkt und aufschliesst. Er schränkt die Handlung zwar räumlich ein, fächert sie aber andererseits durch seine Neutralität in jede nur denkbare Richtung auf. Ich gehe nicht in ein Zimmer, um zu „zimmern“. Wohl schränkt mich das Zimmer ein, es setzt meiner Bewegungsfreiheit Schranken. Doch es schreibt mir nicht vor, was ich innerhalb dieser Schranken zu tun habe. Im Zimmer bin frei, obwohl mich das Zimmer fixiert, mich, wenn man so will, einsperrt und mein Tun auf Zimmergrösse schrumpft. (So kann ich gewisse Dinge in einem Zimmer nicht so gut bewerkstelligen, weil der Raum dazu fehlt, zum Beispiel Fussball spielen oder Radfahren). Doch das Zimmer ist für mich, der ich es benutze, nicht einfach nur ein Zimmer, das tautologisch nichts als Zimmer ist, es ist für mich genau das, wozu ich es in meinem konkreten Fall bestimme. Ich überwinde die Tautologie, indem ich sie annehme. Indem ich mich ihr unterwerfe. Gleiches passiert auf der Bühne. Der Schauspieler ist auf der Bühne so exponiert und eingeschränkt wie ein Manegentier, er hat sich, da ihm ein Körper eignet, ein "Handlungskörper", an eine bestimmte realräumliche Vorgabe zu halten, und die Bühne ist nur insofern vorhanden, als man von ihr abstrahieren kann. Doch durch diese Quantité négligeable erweitert sich die Bühne in jede nur mögliche Richtung, in jede nur mögliche Vorstellungswelt hinein. Sie wird universal. Im Grunde handelt es sich bei diesem Vorgang um einen dialektischen Dreischritt. Um als Bühne funktionieren zu können, darf die Bühne zuerst und vor allem nichts anderes als Bühne sein: sie darf kein Badzimmer, kein Boudoir, keine Garderobe sein. Sie ist tautologisch: die Bühne ist eine Bühne ist eine Bühne... Soweit sie Bühne ist und nichts als Bühne, ist sie inhaltlich neutral. Sie wird freigehalten. Als Bühne benötigt sie gewisse technische und visuelle Eigenschaften, die durchaus variieren können. Deren Reichweite geht aber logischerweise nirgends über das hinaus, was für eine Bühne funktionell erforderlich ist. Was sie brauchbar macht. Insofern ist die Bühne ein Ort künstlich gewahrter Neutralität oder Diskretion. Hierin aber unterscheidet sie sich kaum von einer (gedachten oder wirklichen) Black Box, einem dunklen Raum, der dadurch, dass er nichts Sichtbares enthält, für den Betrachter die Qualität des Unermesslichen besitzt: man sieht keinen Rand, keine Beschränkung, nichts. Und das wiederum ist genau das Gegenteil einer Bühne, die in ihrer räumlichen Struktur sehr klar begrenzt ist. Sie hat eine Rampe, und die Schauspieler treten seitlich oder von hinten in den Bühnenraum ein. Die Bedingung für den theatralen Auf- und Abtritt ist ja gerade die Beschränkung. Die Bühne ist in ihrer Logik das Gegenteil einer Black-Box, aber sie ist auch genau dasselbe. Wir haben also die beiden Raumgattungen, die eine die These, die andere die Antithese, und wir haben die radikale Negation der Bühne durch die Negierung ihrer Beschränktheit, was aber im Grunde dasselbe zu sein scheint. Das heisst, wir haben eine widersprüchliche Identität zwischen räumlicher Beschränktheit und räumlicher Unermesslichkeit. Eine Synthese dieser beiden Begriffe, die uns auf eine dritte räumliche Wirklichkeit bringt, ist das Werden der Unermesslichkeit auf der Bühne. Die Bühne ist also eine kategorische Raumwerdung. Sie beinhaltet, auf der höheren, der theatralen Wirklichkeitsebene, das Element einer Aufhebung im Unermesslichen. Und hier lohnt es sich wieder, den Vergleich zum Film zu ziehen. Anders als man meinen könnte, hat der Film zur Unermesslichkeit keine besonders vitale Beziehung, nicht einmal dort, wo er diesbezüglich aus dem Vollen schöpfen könnte wie im Western oder in der Science Fiction. Es scheint fast, als würde dem Film ausschliesslich daran gelegen sein, an der Schwelle zum Unermesslichen stehenzubleiben, um sich damit zu begnügen, mit der Kamera hinüberzuspähen. Der Blick des Zuschauers wird buchstäblich ferngesteuert. Visuell transportiert der Film eigentlich immer nur das, was man auf Englisch als „Fleeting glimps“ bezeichnet: flüchtige Anblicke in montierter Selektion. Und vor allem auch Durchblicke, denn auf Blickführung versteht sich der Film so gut wie kein anderes Medium. In der Beziehung zum Raum sind es dementsprechend oft nur Übergänge, was im Film zur Wirkung kommt: Türen, Fenster, Schleusen, Gucklöcher, Aus- und Einblicke jeder Art. Der Film zeigt, wohin es geht oder gehen könnte, und dieses Zeigen ist höchst real, es offenbart den Zeige-Charakter des Mediums. Kamera und Montage erzeugen diesen Realismus synekdochisch. Sie konstellieren den Raum künstlich. In perspektivischer und mimetischer Aufsplitterung aktivieren sie ihn wie einen toten Körper, dem man elektrisch erzeugte Muskelkontraktionen aufzwingt, um Leben vorzutäuschen. Jemand rennt, wird verfolgt, jemand irrt durch ein Labyrinth, jemand blickt durch ein Fenster, klettert eine Fassade hoch und erhascht die angsteinflössende Perspektive nach unten.... In der Fähigkeit, auf die Dinge hinzuführen, die Dinge anzudeuten und anzuschneiden, wird der Film selbst zum Raumereignis, ohne dass er irgendein zusätzliches Raumereignis simulieren müsste. Doch sobald er sich einem Raum zuwendet, der mit der Handlung eins werden soll, verliert er seinen Zeige-Charakter und ist gezwungen, im Zusammenspiel von Kameraeinstellung und Montage das filmische Ereignis, mit dem er eigentlich identisch sein möchte, ausserhalb seiner selbst zu simulieren, was ihn teilweise schwächt. Deshalb wirken die meisten Jules-Verne-Verfilmungen so unbeholfen, so pfadfinderhaft bemüht. Als würde ein Turnverein „Hamlet“ an der Reckstange aufführen. Filmische Raumexplorationen erschöpfen sich in Raumsimulationen. Hier versagt das Medium, weil schon die Kamera ein Mittel ist, Raumerfahrung zu simulieren, was dann noch perfektioniert und verstärkt wird, wenn die Kamera, um die von ihr erzeugte Raumerfahrung zu intensivieren, zusätzliche Mittel wie Bewegung oder Visual effects zu Hilfe nehmen muss. Dies aber, so eindrucksvoll es im Ergebnis auch sein mag, arbeitet der Künstlichkeit zu, was der natürlichen Raumerfahrung widerspricht. Auf diesem Gebietet behauptet nun das Theater eine genuine ästhetische Überlegenheit. Wenn auf der Bühne etwas passiert, bin ich als Zuschauer dabei, und was da auch passiert, es passiert in Echtzeit und ungeschnitten. Und es passiert im selben Raum, den ich optisch und physisch, wenn auch mit einer etwas verschobenen Perspektive, mit den Schauspielern teile. Diese Raumerfahrung ist echt und muss nicht simuliert werden. Sie bezieht mich voll mit ein: für eine Bühnenadaption eines Romans von Jules Verne die beste Steilvorlage. Wenn der Theater-Schauspieler nach dem Vorbild einer Jules Verne-Figur in eine Höhle hinabsteigt, den Himmel erkundet, eine Wüste oder einen Dschungel durchquert, geschieht dies nicht in der Horizontalachse wie bei einem Road-movie. Auf der Bühne variiert die Raumerfahrung mit einem Liniennetz zwischen Bewegungspunkten, während der Film im Umgang mit dem Raum quasi den Sehschlitz und die operative Manövrierfähigkeit eines Panzers imitiert. Auch die Zeiterfahrung weicht beim Theater naturgemäss vom „Drive“ des Filmschnitts oder der Kamerabewegung ab: der Theater-Schauspieler fährt nicht einfach dahin, es gibt keinen Fluss des Verwischens und Verwischtwerdens, in den er eintauchen könnte. Der „Stream of Consciousness“, dieses fliessende Getrieben- oder Unterwegssein, wie es der Film so leichthändig suggerieren kann, schliesst die eigentliche Raumerfahrung aus, weil es sich sozusagen in einem permanenten Übergangsstadium befindet. Das Theater erzählt und erfährt den Raum von der anderen Seite her: es platziert den Raum vor den Zuschaueraugen in einer Konkretion des räumlich situierten Erzählens, in dem das Imaginäre und Physische eins werden. Dabei entwickeln sich innerhalb ein und desselben Settings verschiedene mit- und ineinander verkettete Raumsituationen, die schrittweise durchgespielt werden. Schrittweise will heissen: redend, forschend, deutend, umherschreitend. Eine Handlung folgt in Echtzeit auf die andere. Ein Wort folgt in Echtzeit auf das andere, und zwar im gegenwärtigen Moment. Der Schauspieler ist jederzeit da, wo ihn der Zuschauer im realen Raum verortet. Seine Verortung im Raum kann der Schauspieler nicht vortäuschen, obschon er – das ist sein Beruf – alles andere vortäuschen kann und muss. Hier im Raum ist er authentisch und beglaubigt: ein Raum-Inhaber, der den Raum buchstäblich „innehat“. Es ist nicht wie beim Film, wo ein Mensch mit dem allereinfachsten Montage-Trick, dem nicht ortsgleichen Gegenschnitt, in irgendeine Szene hineinmontiert werden kann. Der Filmschauspieler ist kein Raum-Inhaber, er muss sich seine Anwesenheit im Raum erschwindeln oder durch das Medium zurechtrücken lassen. Und oft tritt er dabei selber an die Stelle des Raums, etwa bei Nahaufnahmen. Für die Kamera kann auch das Gesicht zur Landschaft werden. Freilich kann der Film mit starken theatralen Momenten aufwarten, mit Bühnenbildeinstellungen, die ersichtlich im Studio gemacht sind und räumlich sichtbar von Theatersetting inspiriert sind. Von Fellini bis Roy Andersson gehören theaterähnliche Settings zum Stärksten, was der Spielfilm künstlerisch hinbekommt. Der Film kann sich Theatermagie aneignen, bringt sie aber nicht aus sich selbst hervor. Eigentlich ist sie ihm wesensfremd. Der Film observiert den Raum eher, als dass er ihn beschreitet, beobachtet ihn eher, als dass er ihn aufschliesst oder in Besitz nimmt. Mit der doppelten Perspektive des Zuschauerblicks und des Kamerablicks kann der Raum nicht erfahrbar gemacht werden. Im Medium Film wird der Raum auf Abstand gehalten und dementsprechend minimiert: man sieht vom Zimmer auf den Hof. Man sieht den Horizont, in den der Cowboy hineinreitet. Man sieht und erfährt eine perspektivische Blickrichtung. Doch sind das keine spezifischen Raumerfahrungen. Es sind Erfahrungen, die mit Zu- und Übergängen zu tun haben, mit Transit und Fluchtpunkten. Um das Dasein in einem spezifischen Raum und seine Erschliessung geht es hier nicht. Eigentliche Raumsituationen macht der Film selten erfahrbar. Ihm geht es vielmehr darum, woanders zu sein, als man ist. Die Räume, die er uns zeigt, behandelt er im Konjunktiv zwei. Freilich ist das eine Erfahrung, die der Film dem Theater voraus hat. Die räumliche Film-Phantasie ist eine Phantasie der Nichterfüllung, des nicht ganz Dort- oder Hierseins, es ist die Phantasie des Voyeurs, dem sich das Begehrte in dem Masse entzieht, wie er es zu sich heranholt.
4. Die Essenz des Theaters
Der reale Bühnenraum prädisponiert seine Erweiterung ins Imaginative geradezu modellhaft. Eine Analogie aus der Geometrie kann den "Falzvorgang" im Übergang von der Bühne als solcher zur theatralen Bühne vielleicht etwas verdeutlichen: klappt man die Seiten eines Würfels in die Fläche, bekommt man sechs zu einem Kreuz angeordnete Quadrate. Ein Würfel auf die Fläche proijziert, ergibt also ein Kreuz, das man ausschneiden und zusammenfalten kann, um wieder das ursprüngliche Volumen des Würfels zu erhalten. In der Fläche sind die Quadrate (die sechs Seiten des Würfels) ein abstraktes, nicht-gegenständliches Modell, das den Würfel zweidimensional veranschaulicht. Genauso kann der reale Bühnenraum als Modell gedacht werden: den höherdimensionalen Spielraum des Theaters erhält man nämlich erst, wenn sich die Bühne ablöst von der Dimension, in der sie den Zuschauern als Vorrichtung erscheint. Wenn ich einen Würfel in der Fläche betrachte, erscheint er mir als Bastelbogen. Wenn ich eine Bühne ohne den auf ihr in Gang gesetzten Theatervollzug betrachte, erscheint sie mir als Rampe oder Vorrichtung, als das, "was sie nun mal ist". Man könnte auch sagen: als Schauanlage, Bildfläche oder Guckkasten. Die Bühne ist zuerst und vor allem ein Mittel zum Zweck. Und insofern ist sie so neutral und funktional wie ein Zimmer, etwas bloss Apparatives und Mechanisches. Diese Tautologie entspricht dem Würfel in der zweiten Dimension. Nun ist aber ein Würfel nicht zweidimensional, und die Bühne ist nicht mit dem gleichzusetzen, was sie uns sichtbar darbietet. Sobald sie nämlich bespielt wird, fügt sie sich zu einem höherdimensionalen Gebilde, so wie sich die sechs Flächen eines Würfels zu einem Volumen fügen, wenn sie aus der Fläche genommen und in die dritte Dimension aufgefaltet werden. Theater transponiert den Bühnenraum, so wie der Falzvorgang eine Fläche transponiert. Die zunächst noch völlig unkörperlichen Linien und Flächen eines Bastelbogens verwandeln sich durch den richtigen Kniff (eine bestimmte Handhabe oder Kunstfertigkeit) in einen Würfel oder sonst ein geometrisches Volumen. Dasselbe geschieht im Theater in Bezug auf den Raum. Freilich ist die theatrale Wahrnehmung im Unterschied zur Wahrnehmung geometrischer Strukturen etwas Dynamisches und Fliessendes. Hier entsteht keine feststehende Räumlichkeit, die sich im Bewusstsein ein für allemal fixiert, sondern ein offener Erzählraum. Dessen Qualität liegt ja gerade darin, dass er sich nicht fassen lässt, dass er weder die Figuren einengt noch die Handlung allzu sehr determiniert. Dadurch hat er etwas Amorphes, verändert mit jedem Schritt und jedem Wort der Schauspieler Gestalt und Ausdehnung. Das Geschehen, das in ihm abgewickelt oder verhandelt wird, erweitert die Bühne potentiell ins Unendliche und enthebt sie ihrer real vorhandenen Beschränktheit des Funktionalen und Tautologischen. Diese Beschränktheit wiederum ist die unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass die Bühne überhaupt funktioniert. Dass sie "angeht". Denn ein Raum, der an und für sich schon ins Unendliche zielt (ein offener Raum) oder die Neutralität des Guckkastens gegen ein reales Setting vertauscht (Strassentheater und dergleichen) schränkt das Theater ein und nimmt ihm die räumliche Magie, wenn man dabei überhaupt noch von Theater sprechen kann. Selbstverständlich ist nicht alles Performative dem Theater zuzurechnen. Eine Pantomime oder ein Zauberkunststück kann mit grossem Gewinn auch auf der Strasse aufgeführt werden. Theater ist jedoch wesentlich an die Bühne und ihre Bedingungen gebunden. Eigentliches Theater geschieht dann, wenn Menschen performativ auf einen neutralen und tautologisch prädisponierten Raum einwirken, wenn sie auf der Bühne und durch die Bühne zur Handlung kommen. Erst darin verwirklichen sich die spezifisch theatralen Möglichkeiten, die weder im Film noch in der Performance-Kunst zum Anschlag kommen und dort auch nicht zu den tragenden Elementen gehören. Insofern gilt es der Ansicht zu widersprechen, das konventionelle, nicht-improvisative Theater sei wegen seiner Reproduzierbarkeit nicht genügend authentisch. Das Kernelement des Theaters liegt ganz woanders. In seiner etymologischen Herleitung steht das Wort "Theater" (lateinisch "Theatrum") hauptsächlich für den wörtlich verstandenen Schauplatz, die Bühne, den Raum, in dem Theater gespielt wird. Theater meint nicht nur "Theaterspielen", sondern auch den Ort, wo Theater gespielt wird. Theater ist im wesentlichen eine räumliche Kunst. Theater kann improvisativ oder klassisch sein, es kann sich in seiner Reproduzierbarkeit mit dem Film messen oder sich durch happeningartige Einlagen von ihm abgrenzen: für das, was Theater ausmacht, sind solche Unterscheidungen oder Übereinstimmungen nebensächlich. Wenn es etwas gibt, worin sich Theater von andern Reproduktionskünsten abhebt, dann ist es die konstitutive Dialektik zwischen der realen räumlichen Beschränkung und der imaginativen räumlichen Erweiterung. Diese Dialektik setzt die Live-Situation voraus. In gewisser Weise hängt sie an der Live-Situation wie an einem Kleiderbügel, der mit dem Kleid, für das er die Stütze abgibt, nicht zu verwechseln ist, aber doch dafür sorgt, dass das Kleid seine Form behält. Räumliche Beschränkung ist also eine Form, die das Theater haben muss, um überhaupt Theater sein zu können. Wäre diese Form vermittelt, etwa durch Filmmontage oder bestimmte Kameraeinstellungen, könnte man ihre Beschränktheit zu Recht in Zweifel ziehen. Räumliche Beschränktheit lässt sich nur live erleben, in Echtzeit und "vor Ort", und natürlich in Anwesenheit derer, die diese Räumlichkeit mit menschlich limitierten physischen und zeitlichen Mitteln bespielen. (Ein falscher Schritt über die Rampe, und es geschieht ein Unfall. Eine Theatervorstellung von über zwei Stunden ohne Pause, und die Blase fängt an zu drücken). Es ist die reale, momenthafte, nicht mittelbare Übereinkunft zwischen Publikum und Schauspielern, was den gemeinsamen Spielraum heraufbeschwört und konstituiert, eine Übereinkunft, die in kein anderes Medium überführt werden kann. Die Barriere ist absolut. Abgefilmte Theatervorstellungen sind genauso sinnlos wie nachträglich ausgestrahlte Fussballspiele. Im Theater befindet man sich "vor Ort" und ist "dabei", wenn nicht sogar "mittendrin"; alles andere wäre dann schon nicht mehr Theater, sondern dokumentiertes Theater, also eine Art Sekundär- oder Pseudo-Theater, dem die theatrale Essenz, nämlich die reale Raumerfahrung, abgeht. Live-Erfahrung und Ortsbezug schliesslich sich im Theater zu einem perfekten Wechselkreis. Ihn aufzubrechen oder sonstwie zu manipulieren, bedeutet, gegen das Theater zu spielen - oder das Theater in eine andere Kunstform zu überführen. Die Anverwandlung des real Gegebenen durch das Echtzeit-Spiel "vor Ort" betrifft natürlich nicht nur den Raum, sondern auch sämtliche Objekte, die im Raum erscheinen, um ihn zu strukturieren. Beispielsweise Requisiten. Direkt oder indrekt verweisen sie immer auf den Raum und helfen bei seiner Verwandlung mit. Nehmen wir einen Tisch: die mentale Verknüpfung, die ihn als Tisch erscheinen lässt, kann auf der Bühne aufgelöst werden. Der Tisch kann irgendein Versteck sein, in das die Akteure hineinkriechen, ohne dass man dabei zwingend an einen Tisch denken müsste. Der Tisch kann Statthalter sein für die unterschiedlichsten Bedeutungen und Raumsituationen, er kann die Brücke eines Schiffes sein - oder das Floss der Medusa. Letztlich ist der Tisch auf der Bühne genauso metamorphotisch wie die Bühne selbst. Der reale Theaterraum, aus dem sich ein Raum höherer Ordnung herausbildet, eine live gespielte und miterlebte Imagination, löst sich auf, ohne als sichtbares Objekt zu verschwinden, so wie sich der Tisch auflöst und doch nicht auflöst, wenn er trotz seiner mentalen Verknüpfung, die ihn als Tisch kennzeichnet, mit dem theatralen Raum verschmilzt. Er verwandelt sich dann in was auch immer: in ein Versteck oder in das Floss der Medusa. Und bleibt trotzdem unverkennbar ein Tisch, ein banales und vertrautes Objekt, das man kennt und das einen gerade deshalb befähigt, von ihm zu abstrahieren, von ihm auszugehen, von ihm abzusehen. Man tut so, als wäre der Tisch kein Tisch, sondern ein Versteck oder das Floss der Medusa. Und man kann sich das leisten, weil man den Tisch sofort als solchen erkannt hat. Weil man sich mit ihm weiter nicht zu befassen braucht, kann seine Identifizierung spielerisch annulliert werden. Natürlich setzt dies eine gewisse innere Bereitschaft voraus. Es kann nicht als selbstverständlich gelten. Selbstverständlich ist nur die Tatsache, dass ein Tisch ein Tisch ist. Das theatrale "So-tun-als-ob" beinhaltet stets eine Zumutung, man könnte auch sagen: eine gutgemeinte Provokation, die darauf abzielt, Publikum und Akteure dazu zu bringen, im Verhältnis eines stillen Abkommens gemeinsam in die Mimesis der Handlung und der Dinge - und letztlich der ganzen Bühne - einzuwilligen. Hierin verwirklicht sich Theater als Theater. Dem Theater wird die Grundlage entzogen, sobald es nicht mehr live vonstatten geht, das heisst so vonstatten geht, dass alle Anwesenden es zur gleichen Zeit im gleichen Raum erleben. Und vielleicht wichtiger noch: das Theater verliert seine Grundlage, sobald es seine räumliche Beschränktheit abgibt zugunsten eines beliebig erweiterbaren Settings im Aussenraum, in der vermeintlich "dichteren" Realität ausserhalb des Bühnenraums. Theater authentischer gestalten zu wollen, indem man es in die "Lebensrealität" ausserhalb des Bühnenraums versetzt, führt zu einem gravierenden Verlust. Räumliche Beschränkung ist für das Theater nicht nur wahrnehmungstechnisch essentiell. Die Bühne gewährleistet und konstituiert den für das Theater nötigen "Anwesenheitsraum". Die Bühne simuliert kein Raum- oder Wirklichkeitsempfinden wie der Film. Die Bühne ist Raum, sie ist Wirklichkeit. Insofern hält sie eine starke Zumutung bereit, die unverfrorene, weil gegen den Augenschein gerichtete Aufforderung, davon abzusehen, dass die Bühne eine Bühne und der Tisch auf dieser Bühne nur und ausschliesslich Tisch sei. Und die Schauspieler? Auch die sind schliesslich nicht das, was sie zu sein vorgeben. So bleibt das Theater unabdingbar mit dem real-künstlichen Ort seines Vollzugs und dessen real-künstlicher Dauer verbunden. Diese beiden Grundbedingungen zu transzendieren, ist das, worin Theater immer wieder zu sich selbst finden muss, darin liegt seine zeitlos aktuelle Dynamik, seine stets gleichbleibende Unabhängigkeit von technischen und medialen Neuerungen.
2016

"Reise zum Mittelpunkt der Erde" von Jules Verne/Stadttheater Ingolstadt, 2014
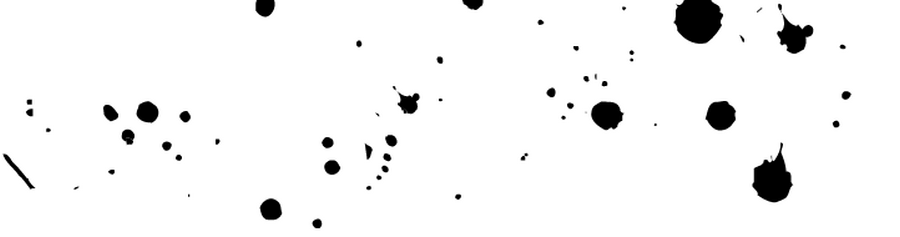 wörter
worte
wörter
worte