Tütensuppe
In der Verlagsstube riecht es nach Suppe. Woher dieser Geruch kommt, ist uns ein Rätsel. Die Bücher, die in der Ecke hinter meinem Rücken mannshoch aufgestapelt sind, riechen jedenfalls nicht, sie sind in Plastik eingeschweisst. Oft, wenn ich meine Arbeit für einen kürzeren oder längeren Moment niederlege, denke ich: schade, dass man hier nicht kochen kann. Es ist nicht ohne Komik, der Geruch ist da, aber die entsprechende Vorrichtung fehlt. Es fehlt die Kochgelegenheit, was mich natürlich ärgert. In einem Betrieb, der zu den modernsten von Düttlishausen gehört, ist das so ärgerlich wie eine wasserfleckige Wand oder ein loses Dielenbrett. Ein Kochherd, auf dem man eine Suppe zubereiten könnte, wäre nun wirklich keine Rieseninvestition. Bei dem nasskalten Wetter, das schon seit Tagen die Landschaft verschleiert, wäre es eine Wohltat, man könnte hie und da etwas Warmes in sich hineinschlürfen, etwas Aufgebrühtes und Nahrhaftes. Leicht zubereitet und schnell genossen, wäre eine Tütensuppe die geeignete Stärkung für zwischendurch. Jolanda, unsere Verlagssekretärin, gibt mir einen Blick des Einverständnisses, sobald ich, halb zu ihr gewandt, halb im Selbstgespräch, den fehlenden Kochherd erwähne. Sie teilt meine Meinung: die Verlagsleitung schuldet uns einen Kochherd. Sie hat es uns versprochen. Aber beim Versprechen ist es geblieben, wahrscheinlich fehlt das Geld, man ist in Schwierigkeiten, die Märkte stagnieren, und so müssen Jolanda und ich uns ohne Kochherd und Tütensuppe durch den Büroalltag schlagen. Und wie zum Hohn hat auf einmal die ganze Verlagsstube nach Suppe gerochen. Nach Aromat und Fett. Der Geruch ist mal stärker, mal schwächer, mal verschwindet er ganz, aber gerade seine Unbeständigkeit bewirkt, dass man sich nicht an ihn gewöhnen kann. Ausserdem durchdringt er alles. Er geht in die Kleider, alles riecht nach Suppe, sogar die Unterwäsche. Jolanda lacht darüber, auch wenn sie meinen Ärger versteht. Sie scheint das alles hier, auch ihre Arbeit, gar nicht so ernst zu nehmen. Wenn nicht gerade das Telefon klingelt, fummelt sie an ihrer Halskette herum und kommt zu nichts. Oder sie fängt an, ihre Bleistifte zu spitzen, es schneit Späne, und der Spitzer raspelt vor sich hin, während sie mir Blicke zuwirft, die ich nicht deuten kann. Oder sie macht Turnübungen. Oder sie schminkt sich, sie schminkt sich oft. Beim Schminken macht sie ein Gesicht, das ganz anders aussieht als sonst: wie eingefroren. Dass es uns momentan an Arbeit fehlt, dürfen wir nicht zugeben, wir behalten es für uns. Wir wissen, dass die Situation jederzeit umschlagen kann: von einer Sekunde zur andern kann Hektik ausbrechen. Sobald ein Auftrag hereinschneit, sobald Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger ein neues Buchprojekt vom Stapel zu lassen, sind Jolanda und ich gefordert bis zum Anschlag. Der Betrieb duldet kein Abseitsstehen. Jolanda und ich sind eingespannt, auch wenn im Moment alles nach Flaute aussieht. Innert Sekunden kann sich ein Umschwung vollziehen, der alles auf den Kopf stellt. Darauf sind wir gefasst.
Der Düttlishauser Klein-Verlag proklamiert seine Kleinheit schon im Namen. Klein-Verlag, das deutet Hausgemachtes an, Provinzielles, ein bunes Potpourri aus Billigbroschüren, Alltagspostillen, Hauskalendern und unbeholfener Küchentischpoesie in Schreibmaschinisten-Typografie. Die Vermieftheit, die uns scheinbar anhaftet, ruft immer auch Spötter auf den Plan. Wir nehmen das gelassen. Natürlich darf man uns nicht mit den grossen Verlagen vergleichen, das wäre unfair. Die Brötchen, die wir backen, sind klein. Klein ist auch unsere Büroräumlichkeit, wir nennen sie Verlagsstube. Jolanda, unsere Verlagssekretärin, ist hauptsächlich für die Verkaufsadministration zuständig, während ich den weitgespannten Vertrieb überwache. Ich verpacke die Bücher und bringe sie auf die Post. Ich verschicke auch die Verlagsankündigungen. Auf das Marketing habe ich mich anfänglich gar nicht einlassen wollen, aber irgendwie bin ich dann doch nicht willens genug gewesen, es von mir fernzuhalten. Es ist mir zugewachsen, und jetzt, da es zu meinen Hauptaufgaben zählt, stelle ich fest, dass ich damit an kein Ende komme. Was nicht heisst, dass ich überlastet wäre. Marketing-Fragen sind eine Nebensächlichkeit. Mit Marketing beschäftigt man sich wie mit einem Mühlespiel, das man, wenn etwas Wichtiges ansteht, auch mal unterbrechen kann, die Steinchen hüpfen ja nicht davon. Marketing ist eine gemütliche Sache. Ich mache das so nebenbei, mit links. Es kitzelt meinen Verstand, ohne ihn zu beanspruchen. Es animiert mich, erfrischt mich. Es ist ja fast nichts. Das Wenige, das an Öffentlichkeitsarbeit anfällt, liegt bei mir unter dem Teller mit dem Schinkenbrot: ich beantworte Briefe und gebe Werbeanzeigen auf, und bei der Gestaltung des Prospektmaterials (jedes neue Buch bekommt eine Begleitbroschüre, die fast so dick ist wie das Buch selber) habe ich völlig freie Hand. Ich gestalte und texte sehr freihändig. Ich zitiere aus Buchkritiken, die nie geschrieben worden sind. Manche Bücher preise ich als Geheimtip an, andere als Sensation. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger sehen in mir den geborenen Marketingfachmann, den sicheren Garanten für eine zukunftsträchtige Verlagswerbung. Sie haben, davon bin ich überzeugt, in den richtigen Mitarbeiter investiert. Würde ich den lieben langen Tag schlapp und unmotiviert in meinem Bürostuhl herumhängen, so könnte ich es mit mir selber kaum aushalten. Ich wäre mir zuwider. Wenn ich fleissig bin, und zwar auch dann, wenn nicht besonders viel Arbeit anfällt, so bin ich es auch für mich, nicht nur für Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger, die mir gar nicht so wichtig sind, sie arbeiten ja nicht mit mir zusammen, ich meine damit, dass wir nicht im gleichen Haus und im gleichen Raum arbeiten. Die Verlagsstube teile ich nur mit Jolanda. Tisch an Tisch arbeiten wir zwar getrennt voneinander, aber doch im gleichen Büro, in der gleichen Verlagsstube. Wir arbeiten im dritten Stock eines sehr alten Hauses im Dorfkern. Die Wände, die uns umgeben, sind trotz mehrfachen Renovierungsarbeiten immer noch mit Rauchlöchern ausgestattet, und der laminierte Fussboden wölbt sich in der Mitte des Raumes zu einem Buckel. Hebt man die Füsse, so rollt man mit dem Bürostuhl automatisch vom Tisch weg. Das einzige Fenster geht auf einen Kaninchenstall hinaus, der an die südseitige Hausmauer angebaut ist. Mit seinem Wellblechdach reflektiert er im Sommer die Hitze. Das Beengte und Ungefällige, das den meisten Dorfkernbehausungen des Flair von Künstlerbuden verleiht, ist hier einem ordentlichen Büro gewichen. In filzstiftbeschrifteten Kartons sind alle Unterlagen verstaut, die je über unsere Schreibtische gegangen sind, und für den Fall, dass uns mal jemand besuchen kommt, steht ein Stuhl mit einem handbestickten Kissen bereit. Eine fürstliche Sitzgelegenheit. Wir haben sie gemeinsam eingerichtet. Jolanda hat das Kissen beigesteuert. Sie nennt es liebevoll “Plumeau”. Jolanda und ich können uns gut vorstellen, dass uns vielleicht mal jemand besuchen kommt, irgendwann, beruflich oder privat, das spielt gar keine Rolle. Wir sind da nicht besonders wählerisch. Wer das auch immer sein mag, der Besuch ist uns willkommen, das “Plumeau” liegt bereit. Allerdings wird diese Person nicht darum herumkommen, die enge, knarrende Holztreppe zu überwinden, die zu unserm Büro hinaufführt und die, wie durch ein Wunder, sämtliche Renovierungsarbeiten unbeschadet überdauert hat. Unten im Parterre hat sich ein schickes Restaurant eingemietet, die "Oase". Dort gibt es den Pausen-Kaffee. Mangels Wasserkocher sind wir beim Kaffeegenuss auf Outsourcing angewiesen. Oft ist das Restaurant überfüllt, und oft sind wir gezwungen, neben dem Kücheneingang zu sitzen. Kein besonders appetitlicher Ort. Was dort gekocht wird, kann man sich nur als etwas Matschiges vorstellen, aus dem ein paar Selleriestängel herausragen. Die Küche ist streng vegetarisch, und die einzige Suppe, die der Koch zustande bringt, ist eine farb- und geruchslose Yoghurt-Suppe, eine zähflüssige Pampe, aus der man den Löffel fast nicht mehr herausbekommt, wenn man ihn einmal hineingesteckt hat. Eine richtige und währschafte Suppe bekommen wir in der "Oase" nicht. Nach Suppe riecht es nur in der Verlagsstube. Mit diesem Geruch, den wir nur schwer mit der Restaurationsküche in Verbindung bringen können, haben wir auszukommen, Jolanda und ich, es ist ein Phantomgeruch, der uns narrt, eine Autosuggestion, in die wir beide verstrickt sind. Ich schnüffle an meinen Kleidern, um zu prüfen, ob sie wieder einmal nach Suppe riechen. Der Geruch ist manchmal da und manchmal auch nicht. Manchmal riecht man ihn sofort, und manchmal muss man an sich herumschnüffeln, damit man ihn in die Nase bekommt. Tatsächlich rieche ich wieder einmal wunderbar nach Suppe. Der Geruch ist von einer Schwere, die mich erschreckt. Ich blicke zu Jolanda hinüber, die sich zum Fenster gedreht hat und mit den Fingerspitzen die herabgezogenen Mundwinkel antippt. Jetzt macht sie einen Kussmund. Im Fensterglas spiegelt sich ihr Gesicht. Sie schminkt sich. Das macht sie oft, mehrmals am Tag widmet sie sich dort ihrem Gesicht, das kein unschönes ist. Ich frage sie, welchen Tag wir heute haben. Keine Antwort. “Jolanda!” rufe ich ihr zu, “hast du eine Ahnung, was heute für ein Tag ist?” Noch immer arbeitet sie an ihrem Mund. Sie hört mich nicht oder will mich nicht hören, und ich behandle sie wie eine Schwerhörige. “Jolanda!” rufe ich. “Haben wir heute Mittwoch oder Donnertag?” Jolanda nickt. “Hmmm,” macht sie. “Hmmm.” Ich neige mich ein wenig nach vorn, um in meinen wild zerstreuten Unterlagen nach dem Terminkalender zu suchen. Aber ich kann ihn nicht finden. Plötzlich tauche ich ab. Ich bücke mich unter den Schreibtisch. Schnuppernd sauge ich den Suppenduft ein, der sich in den Knitterfältchen meines ungebügelten Hemdes eingenistet hat. “Jolanda!” rufe ich, während ich mir das Hemd aufknöpfe, um meine Nase mit dem Unterhemd in Berührung zu bringen. “Hast du heute schon an dir gerochen? Riechst du es auch?” Während ich mich wieder aufrichte, knöpfe ich eilig mein Hemd zu. Jolanda sitzt mir direkt gegenüber, und einen Moment lang habe ich Mühe zu begreifen, was sich mit ihr abspielt. Sie vergräbt ihre Nase in die Kuhle zwischen Ober- und Unterarm. Doch anstatt den Arm zum Gesicht zu heben, senkt sie das Gesicht zum Arm hinunter und krümmt sich dabei zusammen, als hätte sie Bauchweh. “Hmmm,” macht sie. “Hmmm.” Während sie Mund und Nase tiefer in die weiche Armbeuge hineindrückt, wo es kaum Luft gibt, fängt sie an zu kichern. Die dünnsträhnigen blonden Haare sind wirr über das Gesicht geworfen. Sie windet sich auf ihrem Stuhl, der etwas ins Schlingern gerät. Damit sie nicht wegrollt oder umkippt, stemmt sie sich breitbeinig gegen den knarrenden Boden. Nicht zum ersten Mal sehe ich sie derart verrenkt. Jolanda ist Kunstturnerin, auch im Büro macht sie regelmässig ihre Turnübungen. Doch die ungewohnte Sitzhaltung macht ihr anscheinend zu schaffen. Sie zittert, und die Luft, die sie einsaugt, ist für eine Duftwahrnehmung wahrscheinlich viel zu spärlich. Aus dem Kichern wird ein Schlucksen. Ich entschliesse mich, über dieses Verhalten hinwegzusehen, wir sind uns ja einig darin, dass es hin und wieder ganz penetrant nach Suppe riecht. Und wir sind uns auch weitgehend einig darin, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen. “Ja, ja, genau,” sage ich und schiebe mir die Brille auf die Stirn. “Du riechst es also auch. Dieser Geruch, dieser Suppengeruch, dieses unverwechselbare Aromat-Aroma, es schlüpft in sämtliche Kleider und bewirkt, dass wir uns selbst nicht mehr riechen können. Wir verlieren den Eigengeruch. Ich halte das für unzumutbar, Jolanda. Wir sind kontaminiert.” Jolanda nimmt den Arm vom Gesicht und lehnt sich zurück; aus grossen, blaugeschminkten Augen sieht sie mich fragend an. “Kontaminiert?” haucht sie, während sie ihren Schluckauf hinter vorgehaltener Hand zu unterdrücken versucht. Ich bin mir sicher, dass Jolanda unter dem Suppengeruch ebenso leidet wie ich. Auf leeren Magen hält man ihn fast nicht aus. “Es ist übrigens Mittwoch,” sagt Jolanda plötzlich. Sie hat ihren Stuhl an den Tisch geschoben und stöbert in ihren Unterlagen. “Die berüchtigte Phase zwischen Dienstag und Wochenende, eine typische Zwischenphase. Willst du sonst noch etwas wissen?” Endlich hat sie ihren Schluckauf besiegt. Endlich hat sie sich, wenn auch vielleicht nur für einen kurzen Moment, in die Verlagssektretärin zurückverwandelt, die ich kenne und schätze, die Verwalterin des Terminkalenders. Als Verlagssekretärin hat Jolanda die Übersicht und Kontrolle über alles - und besonders über die Zeit, die ich einfach nicht zu fassen bekomme. Ich bin kein Zeitmensch, habe absolut kein Zeitgefühl, die Tage gehen bei mir ineinander über, als ob ich unsterblich wäre... Es ist also Mittwoch. Die Verlagssektretärin hat es offziell bestätigt. Ich erkläre Jolanda, dass die im Erdgeschoss befindliche Restaurantionsküche mittwochs geschlossen sei, also könne der Suppengeruch unmöglich aus der Abluftröhre stammen. Von unten stamme der Geruch nicht. Schon allein deshalb, weil der Koch noch nie eine anständige Suppe gekocht habe. Der koche ja nur so schwules Zeugs. - “Ja,” bestätigt Jolanda. “Das ist wahr.” Sie atmet tief durch. “Das ist wahr.” Sie schaut wieder zum Fenster. Aber diesmal schaut sie durch das Fensterglas hindurch, sie schaut in die Verschwommenheit einer Nässe hinaus, die schon seit Tagen anhält. Nachdenklich betrachtet sie die Bäume, in die der Regen prasselt. Von Jolanda, das weiss ich, ist an diesem Tag nicht mehr viel zu erwarten. Wenn sie anfängt, durch das Fenster hindurchzuschauen, ist sie für die Büroarbeit so gut wie verloren. Sie kommt ins Träumen und ist kaum noch ansprechbar. Darauf nehme ich selbstredend Rücksicht. Wäre ich ihr Vorgesetzter, müsste ich sie zurechtweisen. Da ich ihr aber gleichgestellt bin, fällt es mir leicht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Nur manchmal überkommt es mich, dann muss ich den Chef spielen und einen Standpunkt ausserhalb meines Kopfes einnehmen, einen Überlegenheitspunkt, der sich weit oberhalb meines Scheitels befindet. Wenn ich von dort oben herab zu Jolanda spreche, klingt meine Stimme wie ein Filzschreiber, der mit grossem Druck über ein Blatt Papier gezogen wird. Jolanda lässt sich das gutmütig gefallen, vor allem auch deshalb, weil sie weiss, dass ich einer bin, der es beim Anlaufnehmen bewenden lässt. Hin und wieder spiele ich zwar den Chef, bin aber weit davon entfernt, je einer zu werden. Ich rede ja nur, und es liegt mir völlig fern, Jolanda zu irgendeiner Arbeit zu drängen. Wenn ich mit ihr schimpfe, stehe ich nicht einmal auf, ich verziehe keinen einzigen Gesichtsmuskel, ich schimpfe sozusagen rein verbal. Ich sage Jolanda hin und wieder meine Meinung, das ist alles, und meine Meinung dürfte wohl kaum massgeblich sein. Ich bin nicht derjenige, der uns die Arbeit zuteilt, dafür sind ausschliesslich Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger zuständig. Ohne diese Herren, die wir allerdings selten zu Gesicht bekommen, wären Jolanda und ich schon längst verfault. Auf die regelmässigen Arbeitszuteilungen bleiben wir angewiesen, auch wenn uns die Herren von der Verlagsleitung freundlicherweise eine gewisse Selbstständigkeit zubilligen. Die Abläufe einer Buchproduktion sind ja immer dieselben. Wir wissen jeweils sehr genau, was zu tun ist. Von Gängelei kann keine Rede sein, ganz im Gegenteil, Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger lassen uns in allem freie Hand. Unnötige Anfragen mögen sie nicht. Fast täglich halten sie eine Verlagsleitersitzung ab. Dabei besprechen sie die Bilanzen und projektieren das nächste Buch. Jedes neue Buch ist ein spezielles kleines Abenteuer, besonders für Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger, die das unternehmerische Risiko tragen. Jolanda und ich ertragen es, aber wir tragen es nicht. Wir sind nur die ausführenden Organe. Viel zu sagen haben wir nicht, gelegentlich aber sehr viel zu tun. Anders als Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger, die sich täglich zusammensetzen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, erledigen Jolanda und ich die Arbeit, die übrig bleibt, wenn die wichtigen Entscheidungen schon getroffen sind. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger sind die Architekten, Jolanda und ich die Bauleute. Sobald uns das Verlagsleiterbüro mit einem neuen Auftrag betraut, legen wir uns ins Zeug. Dann zwingen wir uns, schneller zu denken und zu handeln, als es nötig wäre. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger bemessen die Zeit, die sie uns lassen, immer sehr grosszügig. Wahrscheinlich unterschätzen sie Jolanda und mich aus Prinzip. Weil wir nicht zur Verlagsleitung gehören. Daraus ziehen Jolanda und ich einige Vorteile, heimlich, versteht sich, obwohl nichts Unrechtes dabei ist. Weil wir kaum je kontrolliert werden, bekommen wir es irgendwie hin, aus den mit viel Aufwand und Sorgfalt errechneten Zeitplänen ein kleines oder je nachdem auch grösseres Quantum Zeit für uns selbst herauszuschinden. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger wissen nichts davon - und sie brauchen auch nichts davon zu wissen, für sie zählt nur die termingerechte Erledigung. Solange wir mit der Arbeit nicht in Verzug geraten, lassen sie uns in Ruhe. Die Zwischen- und Abgabetermine sind gesetzt: aber auf welchen Wegen und Umwegen wir dorthin kommen, das ist unsere Sache. In einen Neunstundentag passt sehr viel mehr hinein, als uns Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger mit ihren pingeligen Zeitplänen glauben machen wollen. Sie ahnen gar nicht, wieviel Zeit uns bleibt. Manchmal haben wir tagelang nichts zu tun und sitzen einfach nur da, tun zum Schein ein bisschen dies und das, starren aus dem Fenster und warten auf den nächsten Auftrag. Ein Nichtstun ist das nicht, und schon gar nicht ein Sich-Gehenlassen, denn man muss sich doch konzentrieren bei so etwas, sich bereit halten. Während man die Zeit vertut, gleitet man dem nächsten Auftrag innerlich schon entgegen. Doch was anfangen mit der gewonnenen Zeit? Was anfangen mit den zusammengehamsterten Minuten, Stunden und Tagen? Jolanda hat da so ihre eigenen Ideen, sie schminkt sich, macht Turnübungen, spitzt Bleistifte, bis sie fast nicht mehr vorhanden sind, oder bewundert bei strömendem Regen die Aussicht. Untätig zu sein, macht Jolanda nichts aus, sie ist für den Büro-Stumpfsinn geboren. Ich beneide sie. Sie hat das Gemüt einer Weinbergschnecke. Ich selber bin leider nicht so anspruchslos, ich bin schwieriger veranlagt als Jolanda. Ihre Ruhe erscheint mir fast unmenschlich. Ich nerve mich leicht. Ich bin ein Dünnhäuter, der alles spürt: scheisst ein Vogel aufs Dach, spüre ich das sofort. Deshalb lehne ich mich auch hin und wieder auf. Immer sind es dieselben Unzumutbarkeiten, die mir sauer aufstossen. Es gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht, wie wir behandelt werden. Jolanda und ich müssen es hinnehmen, dass wir das fünfte Rad am Wagen sind, wir drehen uns allzu oft im Leerlauf, und ich denke ernsthaft daran, Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger in ihrem Verlagsleiterbüro einmal tüchtig die Meinung zu sagen. Ich hätte ihnen einiges zu sagen, zum Beispiel über das Marketing, das ich ungefragt und ohne viel Begeisterung, aber mit zähem Willen aus dem Dreck gezogen habe. Nie haben sie mir auch nur den leisesten Dank dafür erstattet. Es scheint, als verstünde sich mein Einsatz von selbst, dabei habe ich mir das Marketing gar nicht ausgesucht, ich habe es widerwillig adoptiert, aus reinem Pflichtbewusstsein, niemand ausser mir hat sich darum gekümmert... Und jetzt auch noch die Sache mit dem Kochherd... Bei diesem nasskalten Wetter wäre es eigentlich gar nicht so unangebracht, den Kampf um die Bewilligung eines Kochherds weiterzuführen. Die Gelegenheit ist günstig. Vielleicht haben Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger ein Einsehen, wenn sie das Wetter in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Seit Tagen regnet es Bindfäden. “Jolanda,” sage ich. “Ich gehe jetzt zu Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger und bitte sie ganz persönlich um die Gefälligkeit, das für den Kochherd erforderliche Geld locker zu machen. Es gibt vieles, was zu unseren Gunsten spricht, Jolanda. Und an meiner Hartnäckigkeit ist kaum zu rütteln. Ich bin enorm durchsetzungsfähig, wenn es drauf ankommt, die Reichweite meiner Argumente ist für eine ordentliche Mitarbeiterbeschwerde mehr als ausreichend. Ich denke, dass sich Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger unserm Anliegen auf Dauer nicht verschliessen können. Am Telefon können sie mich abwiegeln, nicht aber, wenn ich sozusagen mit geballten Fäusten vor ihnen stehe. Dann merken sie vielleicht, dass ich es ernst meine. Dass es höchste Zeit ist, einzulenken. Alles, was wir fordern, ist ein Handkocher zum Wasserkochen. Es muss nicht einmal ein Kochherd sein, schon ein Handkocher genügt. Bescheidener geht es wohl kaum, mit dem Schlürfen von Tütensuppen hat noch nie jemand geprotzt. Und trotzdem sind Tütensuppen etwas, wofür man sich begeistern kann. Diese probate Art der Zwischenverpflegung ist etwas vom Wohltuendsten und Glustigsten, was es auf dem Nahrungssektor gibt. Man schlürft oder löffelt das Zeug aus einer Tasse und fühlt, wie es den Bauch wärmt. Nicht zu vergleichen mit Kaffee! Die Wärme des Kaffees ist trügerisch: der süchtig machende, quecksilbrige Bohnenabsud ergiesst sich, kaum hat er den Magenboden erreicht, augenblicklich in die Nervenbahnen und führt dem Körper nichts als ein bisschen Nervosität zu. Bei der Tütensuppe ist das anders. Sie ist voller Nährstoffe, voller echter Lebenswärme und Kraft. Wer arbeitet, ob unter Hochdruck oder nicht, sollte die Möglichkeit haben, sich dieses Kraftmittel täglich zu verabreichen, was man, wie ich glaube, bei diesen Temperaturen weithin für gerechtfertigt hält. Je schlechter das Wetter, desto eher neigt man dazu, sich etwas Gutes zu tun, und es ist nicht einzusehen, warum Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger kein Verständnis dafür haben sollten. Diese Herren kochen auch nur mit Wasser. Auch sie brauchen von Zeit zu Zeit etwas Warmes, um bei Kräften zu bleiben. Deshalb glaube ich und bin sogar fest davon überzeugt, dass es gar nicht so schwierig sein dürfte, sie von unserm Anliegen zu überzeugen, von meiner Überredungskunst, der Überzeugungskraft, die ich hier und jetzt an dir ausprobiere, Jolanda, bin ich jedenfalls felsenfest überzeugt, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, die Erfolgsaussichten sind rosig. Ich darf mich nur nicht zu tief bucken, nicht zu viele Umstände und Worte machen. Am besten, ich gehe ganz ungeniert auf mein Ziel los, stürze mich wie ein Trampel in das Verlagsleiterbüro und knalle unsere Petition mit einem Hueredammisiech! auf den Tisch. So muss man mit diesen Herren umspringen: geradeheraus und ohne jede Zimperlichkeit. Wenn man sie dazu nötigt, sind Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger die grössten Wohltäter, die man sich vorstellen kann.”
Das Gebäude ist scharfkantig und roh, ganz aus Beton. Der Regen hat es mit einem schwärzlichen, speckigen Glanz überzogen. Es ist die ehemalige Landi-Lagerhalle. Gleich daneben, in der Altholzdeponie, schaufelt ein gebrechlicher alter Mann nasse Herbstblätter zusammen. Die Bäume, die zwischen den halbverfaulten Brettern und Kloben ihre üppig belaubten Äste ausstrecken, werden den Alten noch bis in den Winter hinein auf Trab halten. Ich denke, dass ihm das sehr gelegen kommt, denn inmitten des vielen toten Holzes, das ganz ohne menschliche Hilfe vermodert und verfällt, dürfte er sich nicht im geringsten überbeschäftigt fühlen. Als ich auf der Laderampe der Landi-Lagerhalle eine kleine quitschende Metalltür aufschiebe, um ins Trockene zu gelangen, blickt er kurz zu mir herüber und runzelt die Stirn. Ich nicke ihm zu. Das Wasser läuft an mir herab, sickert in die Schuhe. Ich bin froh, dass ich nicht seinen Job habe. Andererseits kann er froh sein, dass er nicht meinen Job hat. Wir können beide froh sein: das verbindet uns. Meine Socken sind aufgequollen, und ich friere, weil mir kalte Luft entgegenströmt. Ich klemme den Durchzug ab, indem ich die Tür hinter mir zudrücke, und setze mich in Bewegung. Die ineinanderfallenden kleinen Echos meiner Schritte klappern lustig hin und her. Aufgemalte Signaturen auf dem schwach neonbeleuchteten Betonfussboden zeigen, wohin ich meine Schritte zu lenken habe. Die massigen Maschinen mit ihren Walzen, Spulen und Bedienungskästen sind links an der fensterlosen Wand aufgestellt, bereit für das nächste Buch, die nächste Broschüre. Die zuständigen Techniker haben immer Bereitschaftsdienst, obwohl nur selten etwas läuft, vielleicht, wenn’s hoch kommt, einmal in einem Vierteljahr. Im Vergleich zur Grösse der Halle ist unsere Druckerei winzig. Dasselbe gilt für das Verlagsleiterbüro, ein Holzgehäuse am anderen Ende der Halle. Von aussen sieht man eigentlich nicht viel. Das Büro ähnelt der improvisierten Koordinationszentrale eines Pfadfinderlagers. Ist es überhaupt ein Büro? Rein baulich betrachtet nimmt es sich recht bescheiden aus: ein aus Sperrholz zusammengenageltes Abteil mit einem Perlenvorhang am Eingang. Dahinter sind Stimmen zu hören. Bittsteller sind hier nicht besonders gern gesehen, schon gar nicht unangemeldet. Was mich betrifft, so habe ich mich absichtlich nicht angemeldet: ich möchte die Herren überrumpeln. Darf ich das überhaupt? Innerlich bereite ich mich auf eine Standpauke vor. Der Perlenvorhang rieselt und klingelt, als ich geduckt durch ihn hindurchgleite. Ich mache noch zwei Schritte in den Raum hinein, dann bleibe ich vor einer unsichtbaren Diskretionslinie stehen. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger sitzen um ein kreisrundes Tischchen herum. Sie konferieren halblaut. Alle vier haben ganz harmlose Gesichter. Mein unerwartetes Erscheinen löst keine erkennbare Reaktion aus. Da kitzelt mich etwas in der Nase, etwas Vertrautes und Betörendes: Kaffee. Der typische Zehnuhrmorgenduft. Im Hintergrund, halb versteckt zwischen wuchernden Hydrokulturpflanzen, summt und blubbert eine Espressomaschine so leise und diskret, dass es schon fast auffällt. Ihre Wasserumwälzpumpe läuft wahrscheinlich im Schlafmodus, vermute ich, der ich mich ja eingehend mit solchen Geräten befasst habe. Ohne die unsichtbare Diskretionslinie zu überschreiten, mache ich der Wand entlang zwei vorsichtige Schritte auf die Maschine zu und versuche, die Marke zu identifizieren: aha, eine V-800, Marke Schönenwerd. Ein Luxusmodell. Ich wende mich nun der Sache zu, deretwegen ich eigentlich hergekommen bin. Ich räuspere mich. Als mich die Herren bemerken, verstummen sie nicht sofort, sondern reden noch eine Weile weiter, wenn auch leiser, das Gespräch wird ausgeblendet und tröpfelt dahin, bis niemand mehr spricht. Jetzt bin ich an der Reihe. Die Herren blicken mich an, ohne eine Miene zu verziehen. Rasch streiche ich mir das nasse Haar aus der Stirn und zupfe an meinen Manchetten, die vor Nässe geschrumpft sind. Ich spreche ganz leise, dem direkten Blickkontakt weiche ich aus. Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger lehnen sich in ihren Sesseln zurück. Auf ihren Gesichtern macht sich nun doch so etwas wie eine menschliche Regung breit. Sie schlagen entspannt die Beine übereinander. Hin und wieder nicken sie beifällig und stossen unverständliche Laute aus, Äusserungen eines Wohlwollens, das keine Worte braucht, weil es aus dem Bauch kommt. Ich begreife mit einiger Erleichterung, dass sich die Herren zwanglos auf mich einstellen. Dass sie mir grossmütig, aber auch ein bisschen belustigt das Wort überlassen, mich einfach reden lassen. Sie hören mir zu, als wäre ich angetreten, um ihnen auf einem seltenen Musikinstrument etwas vorzuspielen, zum Beispiel auf einem Druckwindharmonium. Sie scheinen gespannt zu sein, was da noch alles kommt, und ich habe nicht den Eindruck, dass ich störe, ganz offenkundig geniessen sie es, sich für einmal mit etwas Nebensächlichem, ja völlig Belanglosem abgeben zu dürfen, und so finde ich den Mut, Übertreibungen zu vermeiden. Ich bleibe ganz bei mir selbst. Um meine bescheidene Meinung anzubringen, muss ich kein Getöse veranstalten. Es geht auch anders. Dadurch, dass ich mich weder mit Worten noch mit Gesten übermässig wichtig mache, erziele ich eine Sachlichkeit, die bei Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger ausserordentlich gut ankommt. Das merke ich an der Art, wie sie mir zuhören. Den seit Wochen anhaltenden Regen erwähne ich, ohne zu klagen, ich erwähne ihn nur so nebenbei, mein Anblick sollte genügen, um die Herren nachdenklich zu stimmen. Das Wetter habe ich mitgebracht, es ist ein Beweismittel, das keinen Kommentar braucht. Es spricht für sich selbst. Um meine Schuhe herum hat sich eine kleine Pfütze gebildet, und ich bin mir sicher, dass dieses diskrete Wetterschauspiel niemanden unbeeindruckt lässt. Indessen konzentriere ich mich auf mein Thema. Ich bringe es zur Sprache. Ich lege es dar. Ich spreche gut und flüssig, aber doch so unaufdringlich, dass die Herren jederzeit die Möglichkeit haben, mich ohne Schroffheit zu unterbrechen. Es hat ja auch sein Gutes, wenn man nicht so wichtig ist: man kann dann leichter den Rückzug antreten, sich sozusagen aus der Affäre ziehen, wenn im Auditorium ein Sturm aufkommt, wenn die Zuhörer zu grollen und grummeln anfangen, weil sie ungeduldig werden und darauf brennen, einem das Wort abzuklemmen. Man kann dann mit einem simplen Adieu zur Tür hinaushuschen und braucht nicht noch mühsam den Boden zu verteidigen, auf dem man sich bereits mehr als genug hat behaupten müssen. Flucht ist die beste Selbstverteidigung, sprach der Hasengeneral. Doch Kellerhans, Luginbühl, Steinweich und Höger zwingen mich keineswegs zum Rückzug. Vermutlich würden sie mich reden lassen, bis mir die Stimme versagt, vielleicht mögen sie einfach meine Stimme. Vielleicht mögen sie auch meine Argumentationsweise, die Art, wie ich die Gedanken driften lasse. Nach ungefähr fünf Minuten setzte ich aus eigenem Entschluss einen Punkt. Ich klappe meine Rede zusammen wie einen Regenschirm. Ich hoffe, dass ich weder zu viel noch zu wenig gesagt und mein Anliegen genauso formuliert habe, dass man ihm zumindest ein minimales Verständnis entgegenbringen kann. Über den mausgrauen Hemden rucken die Köpfe, unschlüssiges Schweigen. Anscheinend haben die Herren begriffen, dass da vor ihnen nicht nur ein Mensch, sondern auch eine Frage im Raum steht. Der eine oder andere fasst sich ans Ohrläppchen, räuspert sich, streift seinen Nebenmann mit einem verstohlenen Blick, und ich sehe nun, dass jeder von ihnen die lässig übereinandergeschlagenen Beine voneinander löst, um beide Füsse auf den Boden zu bekommen, den Boden der Tatsachen. Es staut sich etwas, das heraus will. Ich warte auf eine wohlgemeinte Belehrung, eine halbe Zustimmung, eine freundlich verklausulierte Ablehnung. “Das haben wir jetzt aber gehörig zur Kenntnis genommen,” meint Höger und streicht sich dabei über das kleine, viereckige Schnurrbärtchen, das in seinem Plattfischgesicht wie angeklebt wirkt. Ich sehe, dass er schmunzelt, in sich hineinschmunzelt, während Steinweich seine traurige Altmännerstimme erhebt. “Der Düttlishauer Klein-Verlag steht gar nicht so schlecht da...” Steinweich kommt auf die Gesamtsituation zu sprechen, eine alte Gewohnheit von ihm. Sobald er seinen faltigen Mund auftut, spricht er zuerst einmal über die Gesamtsituation, spannt einen Bogen über die Jahrhunderte und die Kontinente hinweg. Er greift sich an seinen Schildkrötenhals, hustet sich den Schleim aus der Luftröhre. “Wie wir mit Stolz behaupten dürfen..” Er zieht Luft ein, seine Schleimhäute flappen. Er muss nochmals ansetzen. “Wie wir, äh, mit Stolz behaupten dürfen, haben wir ein gewisses Segment erobert, das Segment der kleinen Gebrauchsbücher. Doch kein Erfolg ist von Dauer, und die Zeit arbeitet gegen uns. Wie Sie wissen, lieber Freund und Schützenkamerad, gibt uns Revisor und Buchhaltungsspezialist Kellerhans regelmässig zu bedenken, dass die Zahlen stimmen müssen...” Steinweich schnappt nach Luft, hält kurz inne und klaubt eine schildpattgerahmte Lesebrille hervor, die er sich umständlich auf die Nase drückt. Seine Augen vergrössern sich zu schummrigen Untertassen. “Der liebe Kellerhans, unser Herr Zahlmeister,” spritzt es Steinweich aus dem schief gezogenen Maul, während er den anwesenden Finanzbuchhalter spöttisch mustert. Kellerhans reagiert nicht; er ist der Kleinste im Verlagsleitergremium - und auch der Stillste. Wie ein rundum zufriedenes Baby nuckelt er an einem Fläschchen Mineralwasser. Er merkt nicht, dass ihn Steinweich in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit geschubst hat. Der Finanzbuchhalter könnte jetzt seine Meinung äussern, seine Kompetenz unter Beweis stellen. Doch anscheinend erwartet das niemand von ihm. Seine passive Haltung ist allzu bekannt und leicht zu erklären; er beschäftigt sich lieber mit Zahlen als mit Menschen. ”Ja, die Zahlen,” fährt Steinweich fort. “Sie rauben uns den Schlaf, vor allem den Mittagsschlaf. Würden sie stimmen, die Zahlen, die Not wäre behoben, mit der Darberei hätte es ein Ende. Wir wären aus dem Schneider und im Paradies! Doch was soll’s. Kellerhans schreibt den Jahresabschlussbericht nicht in der Absicht, uns die Not vor Augen zu halten, er wirft uns keine Versäumnisse vor, wofür wir ihm dankbar sind. Was wäre denn auch zu machen? Wir wissen ja, wie es steht, und wir tun unser Möglichstes, sind mit Entschiedenheit bei der Arbeit und überlegen uns tagtäglich, wie es weitergehen soll. Wir, die wir alles in Bereitschaft halten, um beim geringsten Aufscheinen einer günstigen Bedingung den Erfolg anzupeilen, brauchen uns nichts vorzuwerfen. Wir tun das Richtige. Und wenn es sein muss, tun wir es auch blind. Ich - und ich sage das als der Dienstälteste an diesem Tisch - lese den Jahresabschlussbericht schon seit Jahren nicht mehr. Was interessiert mich der Geschäftsgang? Ich lasse nicht zu, dass er mich entmutigt. Ich ducke mich unter ihm hinweg. Ich bleibe auf Kurs. Ich leiste meinen stillen Beitrag, unbekümmert um irgendwelche Zahlen und Prognosen, die ich so weit wie möglich von mir fernhalte, um nicht kopfscheu zu werden. Lieber konzentriere ich mich auf Dinge, die ich auf meinem Schreibtisch hin und herschieben kann. Zum Beispiel kleine Zettelchen mit unleserlichen Notizen drauf...” Mit seinen schweren, leberfleckigen Händen tastet Steinweich auf dem Tisch herum, auf dem allerdings kein einziges Zettelchen liegt, die Hände patschen ins Leere, und Steinweich verzieht sein Gesicht zu einem Lachen, das zu einer Grimasse erstarrt, ein schrecklicher Anblick: das Steinweichsche Gelächter hängt mit einer Kiefersperre lautlos in der Luft. “Als Verleger wird man bescheiden,” bemerkt Luginbühl. Mit ihm habe ich rechnen müssen. Luginbühl ist bekannt dafür, dass er sich erst zu Wort meldet, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber wenn er sich dann erst einmal zu Wort gemeldet hat, beisst er sich an seinen Zuhörern fest wie eine Zecke. Allem Anschein nach hat Steinweich das Heft aus der Hand gegeben, und Luginbühl sieht sich nun zum Einschreiten genötigt, damit das Verlagsleitergremium die von Steinweich nur mühsam aufrechterhaltene Autorität nicht verliert. Luginbühl, von dem man munkelt, er sei der rechtmässige Verlagsinhaber und die grosse graue Eminenz hinter allen zukunftsweisenden Entscheidungen, die die dauerkonferierende Verlagsleitung nach streng demokratischen Kriterien zu treffen pflegt, wirft den Kopf nach hinten und greift sich flüchtig an den wulstigen Krawattenknopf. Mit seinen stahlblauen Augen nimmt er mich ins Visier, und auf seinem knochigen Gesicht erscheint ein Lächeln, das immer dünner und beinahe spitzig wird, einen Zug ins Giftige bekommt. “Wie oft prustet man in die hohle Hand, wenn man die eigenen Druckerzeugnisse durchlättert!” Luginbühl lässt seine mageren Fäuste hinauf- und hinabsausen. Er spricht betont langsam, und was er mit seinen Fäusten macht, sieht aus wie Schattenboxen. “Buchprospekte! Bücher!” schreit er plötzlich, während er nach allen Seiten zierliche Schläge austeilt.. “Ha! Diese ganze Mühe! Signale senden wir aus, Leuchtrakten schiessen wir ab, Pauken und Trompeten erschallen, sobald wir unsere Druckerpresse anwerfen! Bücher werfen wir auf den Markt, viele, viele Bücher! Und was kommt zurück? Waseliwas?” Luginbühl erstarrt, als horche er auf ein Mäusegetrappel. “Waseliwas?” wiederholt er flüsternd. Und nochmals, kaum hörbar: “Waseliwas?” Seine Augen gehen von Gesicht zu Gesicht. Jeden der Anwesenden röngt er mit seinen stahlblauen Augen, auch mich, den ungebetenen Gast. Luginbühl hat sich langsam aus seinem Sessel erhoben. Mit angriffslustig geneigtem Nacken steht er da und schnauft. Ich merke, dass ich gar nicht das Thema bin. Es geht hier um Fragen, die nichts mit mir zu tun haben - und erst recht nicht mit meinem Anschaffungswunsch. Ich habe, so sehr ich mich auch ins Zeug gelegt habe, keinen festen Boden gewonnen, keine Zusage, nichts. Ich habe nicht das Geringste in den Händen, um von hier zu verschwinden. Also tue ich nichts. Ich warte ab. Luginbühls Blick lässt mich vermuten, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist. Ja mehr noch: dass sie eigentlich schon immer festgestanden hat. Das Schicksal, sagt dieser Blick, ist vorbestimmt; alles kommt, wie es kommen muss. Ein Mensch mit solchen Augen hat etwas Unverständliches. Man weiss nicht, woran man bei diesem Menschen ist, der seine Augen wie Leuchtdioden gebraucht. Man fühlt sich von diesen Augen angeleuchtet, durchleuchtet sogar, aber alles Persönliche behalten sie für sich. Nach einer Weile schnippt Luginbühl, wie um sich von einer Selbsthypnose zu befreien, mit den Fingern zweimal in die Luft, murmelt eine Entschuldigung und setzt sich wieder auf seinen Sessel. Der klein- und rundgewordener Mund geht erneut in die Breite. Luginbühl lächelt schlau, ein bisschen triumphierend. “Die Arbeit in einem Verlag hat wenig mit Öffentlichkeit zu tun, viel aber mit Papier. Wir sind Papierarbeiter, wir bauen Luftschlösser aus Papier, also Papierschlösser, wenn man so will. Das klingt bescheiden. Doch Bescheidenheit kann unter Umständen der Schlüssel zum Erfolg sein. In unserm Verlag, der sich traditionsgemäss in einem relativ begrenzten örtlichen Rahmen bewegt, wird Bescheidenheit mit Grossbuchstaben geschrieben. KEIN VERLAG IST KLEINER ALS DER DÜTTLISHAUSER KLEIN-VERLAG! Stammt dieser Spruch nicht von Ihnen? Sie sind doch derjenige, der diesen Slogan ausgetüftelt hat, diesen Schlachtruf unseres Verlagshauses, den man mündlich gar nicht wiedergeben kann. Man beachte die von Ihnen gewählte Typographie! Jeder Buchstabe gross, wahrhaftig, mit dieser Pointe könnte man einen Elefanten erschlagen. Unser Verlagsmaskottchen ist allerdings kein Elefant, sondern ein stupsnasiger Gartenzwerg, der in ein winziges, kaum fingernagelgrosses Büchlein blickt - oder gügselt, wie man auf Mundart sagt - und sich dabei knapp neben der ein wenig schief sitzenden Zipfelmütze am Kopf kratzt. Dieses Kratzen ist nicht etwa ein Zeichen von Ratlosigkeit; es stellt die Überlegung dar, das Für und Dawider, das sorgsame Abwägen. Was ist gut? Was nützlich? Was sinnvoll? Bevor wir ein neues Buch herausgeben, überlegen wir uns solche Fragen doppelt und dreifach. Auch unsere Leser stellen sich solche Fragen. Sie kaufen ein Buch, damit sie mit ihren Fragen nicht so allein sind. Vielleicht finden sie in unsern Büchern keine Antworten, aber wenigstens sind sie dabei nicht so allein. Sie finden Zuspruch. Und das ist doch immerhin etwas. Es ist sogar sehr viel. In unsern Büchern ist gesammelt, gesichtet und geprüft, was der beschränkte menschliche Erfahrungsschatz hergibt, und wenn das auch nicht genügt, um die Fragen unserer Leser zu beantworten, so ist es doch das Beste, was wir ihnen geben können. In dem, was wir für sie zubereiten, finden sie sich aufgehoben. Unsere Bücher haben etwas fraglos Selbstverständliches. Sie sind wie Haushaltsgegenstände. Wir machen Bücher, die schön und nützlich sind oder zumindest den diesbezüglichen Anspruch nicht völlig verhunzen: Wanderführer, Pflanzenbestimmungsbücher, Vogelbestimmungsbücher, Pilzbestimmungsbücher, Insektenbestimmungsbücher, Vitamin- und Kalorientabellen, Handarbeitsbücher, Gartenratgeber, Sonntagsgeschichten und Feierabendlyrik. Für jeden Leser, jede Leserin ist etwas dabei, und selbstverständlich kommen auch jene auf ihre Kosten, die das Lesen als zu mühsam empfinden und lieber Bildli anschauen. Unsere Bildli sind so in den Text hineingesetzt, dass sie einem direkt ins Gesicht springen, und der Text ist ignorierbar, weil er darauf verzichtet, sein typographisches Korsett zu sprengen. Er sieht gut aus und passt genau in die vorgegebenen Spalten. Er ist ein Kunstwerk. Den besten Umgang damit findet man, indem man das Lesen zwar als Möglichkeit in Betracht zieht, es in Gedanken quasi anschneidet, aber den Text dann doch nicht einfach nur als Text, sondern vor allem als Gestaltungselement auf sich wirken lässt, also auch optisch. Wir vom Klein-Verlag sorgen dafür, dass man unsere Texte ästhetisch geniessen kann, ohne dass man die einzelnen Wörter und Sätze zu lesen bräuchte. Von denen gibt es ohnehin zu viele, man käme ja aus dem Lesen gar nicht mehr heraus, wenn man alles lesen müsste, was in der bis obenhin zugetexteten Welt an Druckbuchstaben fortlaufend produziert wird. Also fängt man am besten gar nicht mit Lesen an. Lesen ist eine schlechte Gewohnheit, eine Folge geistiger Verluderung. Wer das Lesen aber schon so weit vorangetrieben hat, dass es ihm zur zweiten Natur geworden ist, zur gänzlichen Daseinsorientierung, der sollte seine Lesemanie zumindest versuchsweise ein bisschen zügeln. Sie ist schädlich. Sie verengt das Denken, die Wahrnehmung und das Empfinden. Sie führt dazu, dass man vor lauter Literatur die Buchstaben nicht mehr sieht. Das Lesen sollte man sich abgewöhnen, bevor es einen blind macht für die Schönheit der Buchstaben, die Schönheit des Schriftbilds, die Schönheit der Setzkunst und der Druckgrafik. Oder die Schönheit eines weissen Blatt Papiers! Wie wohltuend ist zum Beispiel ein schönes weisses Blatt Papier, das uns über nichts belehren will! Wir vom Klein-Verlag gehen hier mit gutem Beispiel voran, wir drängen uns niemandem auf. Bei uns erübrigt sich das Lesen. Oder es wird ganz einfach mitgeliefert als etwas, das man bei Gelegenheit ausprobieren kann. Ganz zwanglos. Es sind vor allem die Bildli, die den Lesern den Inhalt unserer Bücher näherbringen sollen, wobei die Texte ja nicht wegfallen, sondern jederzeit konsultiert werden können. Unsere Texte, das möchte ich betonen, sind nicht dazu gemacht, die Leser zu quälen. Autoren, die ihre Leser mit zu langen und zu breiten Texten quälen, missachten das oberste Gebot des Büchermachens. Ein Buch hat so beschaffen zu sein, dass es in jeden gutbürgerlichen Leserkopf hineinpasst. Allzu viele Manuskripte, die uns von hoffnungsfrohen Freizeitautoren zugestellt werden, lassen die Leserfreundlichkeit auf fast schon impertinente Weise vermissen. Wir vom Klein-Verlag geben hier Gegensteuer; wir vertreten die Auffassung, dass das gedruckte Wort keine Überwältigung sein sollte, sondern ein faires und ausgewogenes Angebot. Das gedruckte Wort sollte pfleglich und sanft mit den Lesern verfahren, sie nicht nötigen, nicht plattwalzen, denn selbstverständlich bevorzugen die meisten Leser Bücher, die ihnen die Freiheit lassen, auch nicht zu lesen. Dieses Bedürfnis respektieren wir, indem wir die einzelnen Wörter und Sätze ins Glied zurücktreten lassen, wo sie mit der Textform verschmelzen. Text als Form, nicht als Inhalt. Das ist unser Rezept. Der schön präsentierte Text braucht keinen Leser, der ihn beackert. Unsere Bücher sind leserfreundlich, das heisst handlich, sie sind sowohl schön als auch brauchbar, und ich möchte jeden, der ein Buch von uns kauft, ausdrücklich dazu ermuntern, das erworbene Buch in die Brusttasche zu stecken, um es so nah wie möglich am Leib zu tragen. Direkt vor dem Herzen! Gerät man in eine Schiesserei, ist es vielleicht nur diesem Buch zu verdanken, dass man am Leben bleibt. Das ist es, was Literatur so wertvoll macht: ihre Manifestation in Buchform. Unsere Bücher sind kompakte Erzeugnisse technischer Materialverarbeitung. Sie können Kugeln auffangen, Stösse dämpfen, Schläge einstecken. Stets sind sie da, wenn man sie braucht, es sind Wegbegleiter. Physische sowohl als auch psychische. Griffbereit und verlässlich bieten sie ihre Hilfe an. An das Klein-Verlag-Buch kann man sich halten in jeder Lebenssituation. Nie wieder Ratlosigkeit, nie wieder Langeweile. Das ist ein Versprechen. Jedes Buch, das unsere Druckerei verlässt, ist ein nützliches Utensil, das man überallhin mitnehmen kann wie ein Schweizer Sackmesser. Vielleicht, aber das ist nur so ein Gedanke, kommt das Wort Buch ja von buchen: wer ein Buch kauft, bucht die Reise, die er mit diesem Buch unternehmen wird, er checkt sich ein, ohne schon zu wissen, wohin die Reise geht. Du fährst mit, sagt ihm das Buch, sobald du deine Nase oder ein Lesezeichen in mich hineinsteckst. Oder umgekehrt: man nimmt das Buch auf eine Reise mit, auf eine Luftreise beispielsweise. Bei böigen Winden in einem ständig absackenden Flugzeug klammert man sich dankbar an ein Buch und findet darin ein Stück Heimat, ein Stück Grund und Boden. Aus dem Lesen muss man keine grosse Affäre machen. Es erschliesst sich auch dem Leseunkundigen. Wenn man das Buch, mit dem man sich befassen möchte, mit sich mitführt und es vielleicht hie und da aufschlägt, um irgendein Bildli zu betrachten, so hat man den Kontakt zum Inhalt bereits hergestellt. Ohne zu lesen, liest man aus dem aufgeschlagenen Buch all jene Dinge heraus, mit denen man sich näher befassen möchte und mit denen sich zu befassen ein umso grösserer Anreiz besteht, als diese Dinge nicht nur durch ihre textliche Beschreibung Gestalt annehmen, sondern vor allem auch durch die sorgfältig ausgewählten und arrangierten Bildli, in denen das betreffende Anschauungsmaterial zu seiner wahren Bestimmung findet. Pilze, Blätter, Blüten, Wildfährten: unsere Bildli sind ebenso zahlreich wie informativ. Sie erklären ohne übermässigen Wortgebrauch, was Sache ist. Sie erklären Welt und Natur. Sie erklären alles. Natürlich kann man die Bildli auch um ihrer selbst willen anschauen, ohne System im Kopf, ohne die geringste Absicht kann man zwischen den geleimten Buchseiten auf Entdeckungsreise gehen. Die Bildliwelt im Buch ist grösser als die Welt da draussen, das kapieren schon die kleinen Kinder, also Kinder im Vorschulalter, wenn sie mit ihren Fingerchen auf die abgebildeten Blätter und Blüten zeigen, freudestrahlend, weil sie die Blätter und Blüten wiedererkennen, die sie eben noch auf einem Wald- oder Wiesenspaziergang gesehen haben. Aber jetzt erst, in der nachträglichen Betrachtung, können sie diese Dinge auch würdigen.... Natur! Was heisst das schon? Die Natur ist nichts. Während das Naturwüchsige in seinem real erlebbaren Naturzustand keine besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht und selten bestaunt wird, erhält es in einem Bildlibuch eine ganz eigene Ausstrahlung, erscheint als etwas Faszinierendes. Abbildungen - oder sagen wir ganz einfach Bildli - verfehlen ihre Wirkung nie. Sie enthüllen die Wirklichkeit, indem sie das Sichtbare sichtbarer machen, es in einer Art und Weise vor uns aufleuchten lassen, dass wir es als wesentlich erkennen. Als wesentlich! Sie zeigen die Pracht und Einfalt der Dinge um uns herum, sie offenbaren das Selbstverständliche dieser Dinge und lassen uns über sie staunen. Und weil auf den Bildli alles so echt und ursprünglich dasteht, wie es draussen in der Natur nirgends zu finden ist, staunen selbst wir noch, die Erwachsenen, wenn wir eine schöne Naturaufnahme entdecken. Dergestalt durchtränken uns Photos, aber bis zu einem gewissen Grad auch Zeichnungen und Farbillustrationen, mit Wirklichkeit und machen uns süchtig nach noch mehr Wirklichkeit. Ein Druckfehler ist bei weitem nicht so schlimm wie ein schlechtes oder falsch eingesetztes Bildli. Dass unsere Bildli mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als unsere Texte, liegt vielleicht am Vierfarbendruck, vielleicht aber auch daran, dass die meisten Menschen von Natur aus – unsere Gene sind ja bekanntlich katholisch - auf Bildli programmiert sind, auf Bidli achten und reagieren sie, während sie das Geschriebene leichthin überfliegen. Wenn wir uns also Fehler erlauben dürfen, dann bestimmt nicht im Bereich der Bildli. Einen Druckfehler kann man überlesen, die Sinnhaftigkeit eines Wortes bleibt immer die gleiche, egal wie man es dreht, selbst wenn man seine sämtlichen Buchstaben zu einem Chrutt- und Rübensalat verrührt, ist es noch immer kenntlich als das richtige Wort mit der richtigen Bedeutung. Ein Druckfehler stört den Lesefluss kaum. Doch ein falsches Bildli übersieht niemand. Wird ein Text, der von der Festnahme einer Räuberbande berichtet, versehentlich mit einem Bildli kombiniert, auf dem der versammelte Bundesrat in die Kamera lächelt, kann man sich das Ausmass der Leserreaktionen gar nicht ausmalen! Wenn es um Bildli geht, sind die Leser empfindlich, hier stehen sie geistig auf dem Wachtposten und zielen mit dem Luftgewehrli der Entrüstung auf alles, was sie stört. Was sie stört, und sei es auch nur für einen Augenblick, brennt sich ihnen ein, bleibt haften, wie man so schön sagt, und zieht die erstaunlichsten Konsequenzen nach sich. Was wir freilich erst zu spüren bekommen, wenn das Störende schon nicht mehr rückgängig zu machen ist, wenn also der Ruf nach Korrektur zu spät kommt und uns infolgedessen die Hände gebunden sind. Gedruckt ist gedruckt. Da gibt es nichts. Beanstandungen treffen uns ins Mark, machen sie uns doch bewusst, dass es uns – auch unter Berücksichtigung aller Sorgfaltsregeln – niemals gelingen wird, fehlerlos zu arbeiten. Schitt häppens. Fehler passieren. Passieren immer wieder, und zwar im doppelten Wortsinn: sie passieren die Kontrollschranken, schlüpfen durch, und schon ist es - passiert. Immer ist es ein Versehen, das man hätte verhindern können, hätte man besser aufgepasst. Hätte man diese oder jene Vorsichtsmassnahme getroffen. Hätte man, hätte man. Im nachhinein rauft man sich die Haare. Schwer zu fassen ist die Zufälligkeit, mit der Fehler auftreten, die Willkür, mit der sie zuschlagen. Wie auch immer, anscheinend muss es einfach so sein, dass sie sich immer wieder in die Imprimatur einschleichen und sogar in den Druck. Unachtsamkeiten und Aussetzer, aber auch die berüchtigten Launen des Zufalls werden drucktechnisch multipliziert, sie werden gestreut, verbreiten sich explosionsartig, und auf einmal ist es zu spät für irgendwelche Eingriffe, das Buch ist fertig, jeder Fehler darin publik, ein ewiges Schandmal... So richten wir uns mit dem Büchermachen nach und nach zugrunde. Unsere Bücher vernichten uns, die Geschöpfe vernichten ihre Schöpfer: das alte Lied. Indem wir vom Büchermachen einfach nicht lassen können, indem wir immer weiter und weiter machen, jedem Buch, das wir herausgeben, ein neues Buch hinterherschieben und diesem wiederum ein noch neueres Buch und so weiter, manövrieren wir uns in die totale Selbstzerstörung. Auch finanziell. Die heutige Zeit, die Kapitalmärkte. Sie kennen das Problem. Und ich hoffe auf Ihr Verständnis. Wir von der Verlagsleitung kämpfen ums Überleben, unser eigenes, aber auch das Überleben der Bücher insgesamt. Sie, junger Mann, haben es gut, Sie haben noch Alternativen im Leben. Eine billige Arbeitskraft kann man überall gebrauchen."
Als Luginbühl eine Woche später bei uns anruft, gibt ihm Jolanda höflich zu verstehen, dass sie unzuständig sei, leider, aber sie wolle ihn gleich weiterverbinden zu einem Mitarbeiter, der für diesen Zuständigkeitsbereich zuständig sei. Und so verbindet sie Luginbühl weiter zu mir. „Er hat was von Tütensuppe gesagt,” flüstert sie aufgeregt, während sie auf den Telefontasten herumdrückt. “Er hat Tütensuppe gesagt!” - „Gut,“ sage ich und setze mich kerzengerade hin. Mein Telefon schrillt, und ich nehme es feierlich ab.
2011
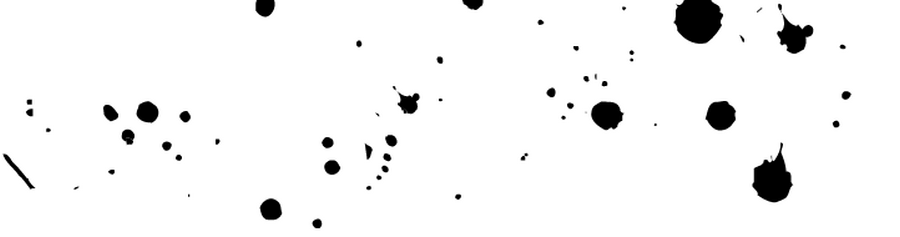 wörter
worte
wörter
worte